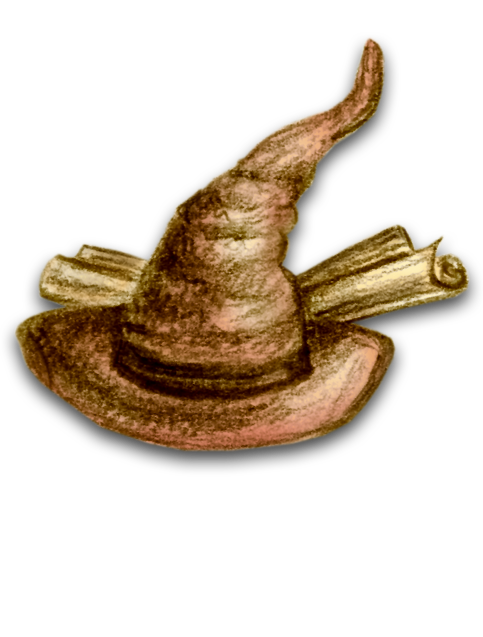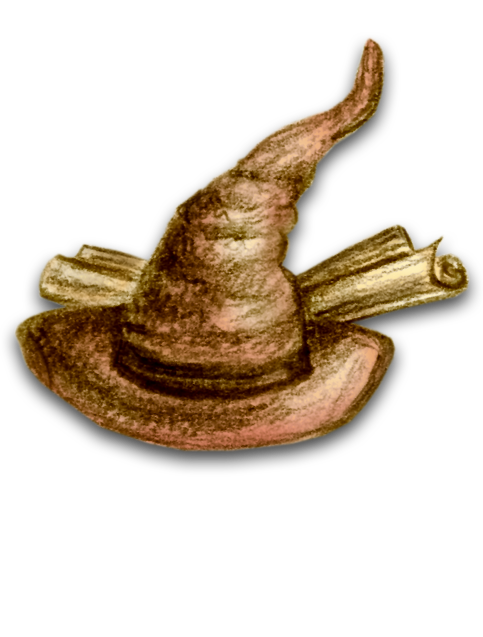Es war so viel Zeit vergangen und nichts hatte zu seiner Genesung beitragen können. Jetzt lag er dort in seinem weichen Bett, umgeben von den besten Ärzten, die das Land unter der Sonne zu bieten hatte. Nichts hatte geholfen, keine Tinkturen, keine Aderlasse. Kein einziges Gebet war vom Einen erhört worden, und mit jedem Tag, der verstrich, war der Prinz immer blasser und schmaler geworden. Sein schönes Gesicht schien durch die lang anhaltende Krankheit wie aus Wachs gegossen zu sein, und seine Augen, die schon so manches in dieser Welt gesehen hatten, waren nun blind gegenüber der Zeit, die ihre Spuren an den Bäumen und Büschen hinterlassen hatte. Aus dem Winter war der Frühling geboren worden. Doch wie es schien, bewegte sich das Schicksal des Prinzen rückwärts, denn sein Frühling schien beendet und sein Winter war nun angebrochen.
Neben dem Bett saß auf einem Stuhl seine Schwester in einem schlichten schwarzen Samtkleid und hielt seine zerbrechlich wirkende Hand. Wie lange war es wohl her, daß sie sich ihm so vertraut genähert hatte? Betrübt hielt sie seine Hand an ihre Wange. Wie weich seine Haut geworden war, wie die eines neu geborenen Knabens. Dabei hatte diese Hand gelernt, ein Schwert zu führen, um sein Land und sein Leben zu verteidigen. Doch nun konnte er keine Waffe mehr halten, um gegen den Schlaf anzukämpfen, der über ihn zu siegen drohte.
In ihren Erinnerungen jagten sie gemeinsam mit den besten Pferden ihres Vaters über die Felder der Bauern. Sie waren frei gewesen, so frei wie der Wind, nein, sie waren der Wind gewesen und frei sich zu benehmen, wie sie wollten. Sie hatten gejagt, sich gemeinsam über den Sieg gefreut und waren gemeinsam ob ihrer Blindheit gegenüber den Bedürfnissen der einfachen Leute untergegangen. Dieser Fluch hatte sie gespalten. Seit damals war er ihr fremd geworden. Wie oft hatte sie sein Handeln verflucht, wie oft hatte sie verflucht zwar die Erstgeborene zu sein, aber eine Frau und somit keinen Anspruch auf das Erbe zu haben.
Und nun war aller Hader vergessen, nun waren sie wieder Bruder und Schwester und brauchten einander. Er brauchte sie. Dunkle Locken umrahmten sein Gesicht, irgendjemand hatte den Bart gestutzt. Die Prinzessin hob die Hand und strich ihrem Bruder zärtlich über die Haare. Ihr Vater hatte ihr verboten, einen hilfreichen Zauber über ihn zu legen, und diesen Ärger trug sie immer noch im Herzen. Sie hatte sich über diese Anweisung selbstredend hinweggesetzt und einen Apparatus konzipiert, der den körperlichen Zerfall ihres Bruders zum Stillstand bringen würde.
Sachte atmete der Prinz, und seine Brust hob und senkte sich. Bald schon würde er wie tot wirken, nicht wie jetzt, wie ein Schlafender.
Leise trat die alte Poenahochgeweihte aus fernen Landen hinter sie und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Es war so weit, sie würden den Zauber jetzt wirken. Die Prinzessin beugte sich über ihren Bruder und küßte ihn auf die Stirn, wenn die Maschine zu arbeiten begann, dann würde sie ihn nicht mehr berühren können, nichts konnte dann mehr durch die Sphäre der Facetten dringen.
Die junge Frau stand auf und blickte zu der kleineren Frau hinunter, die sie aus olivgrünen Augen schweigend musterte.
Es war an der Zeit.
Die Poenageweihte, die von ihrer Landesgräfin hier her entsendet worden war, war eine Frau, die trotz ihres fortgeschrittenen Alters, eine Kraft ausstrahlte, die an einen Baum erinnerte, der dem Anbeginn des Lebens beigewohnt hatte. Es war der Prinzessin vorgekommen, als würde sie nach Hause kommen, als wäre sie trotz der ruppigen Art der Poenahochgeweihten, in ihrem Schoß daheim. Es war zu einer Begegnung gekommen, die die reale Welt weit hinter sich gelassen hatte. Es war einfach passiert, daß die Barrieren, die Mauern, die man sich ein Leben lang erschaffen hatte, einfach mit einem Lächeln überwunden worden waren. Sie waren sich ohne Lügen, ohne Masken begegnet, und hatten ohne Worte ein Übereinkommen getroffen, daß sie die unterschiedlichen Religionen, der sie angehörten, außen vor lassen würden. Was sie verband, was die ältere Frau in der jüngeren gefunden hatte, das konnte die Prinzessin nur erahnen und nie und nimmer in Worte fassen. Es war einfach geschehen, und so schufen sie zum ersten Mal aus der Mechanik des Apparatus, dem Wirken der Magie und dem Strom der Natur ein Ganzes in seiner Vollkommenheit.
Zwischen den bizarr anmutenden, silberschimmernden Metallteilen, die um das schlichte Bett des Schlafenden angeordnet waren, spannte sich nun eine Hülle, die wie eine Seifenblase in allen Farben schillerte. Die Maschinenstreben unterteilten den Stoff der Zeit, so daß der Eindruck eines Libellenauges entstand. Doch eine Facette fehlte, es war das Tor Poenas, daß den Silberfaden hielt, der sich irgendwo in der Unendlichkeit der Sphären verlor. Sollte diese Verbindung zwischen dem Geiste des Prinzen und seinem Körper durchtrennt werden, dann würde er für immer verloren sein.
Seine Schwester mußte sich nicht anstrengen, um diesen Faden im Astralen Raum sehen zu können. Er sproß dem Schlafenden unterhalb seines Herzens aus der Brust und vereinigte sich mit einem zweiten Strom, der ihm aus der Stirn entfloh, um sich aus dem künstlich geschaffenen Raum seiner Konservierung in die Unendlichkeit zu winden.
Zufrieden nickten sich die beiden Frauen zu. Sie hatten eine perfekte Verbindung aus Magie und Wirken geschaffen, ein kleines Wunder.
Wieder verging einige Zeit, als die Prinzessin mit einer neuen Hoffnung für ihren Bruder zurückkehrte.
Strahlend schön, wie der Schein der Sommersonne auf goldenem Korn, lag die liebe Gemahlin des Prinzen auf der Liege. Ihr adelig geschnittenes Gesicht war angespannt, doch kündigte es von keiner Angst vor der kommenden Prüfung. Sie trug tapfer den Kummer im Herzen, daß ihr liebster Mann neben ihr im Raume lag und schon seit Monden nicht mehr in der Lage gewesen war, sie in seine Arme zu schließen. Er war gegangen, und niemand wußte, wohin ihn seine Schritte gelenkt hatten. Seit Anbeginn seiner Reise hatten Träume sie geplagt. Jede Nacht war der selbe Schrei zu ihr gedrungen, und jeden Morgen hatte sie die Botschaft wieder vergessen. Ihr Gemahl rief nach ihr, doch was er ihr sagte, das konnte sie nicht verstehen.
Und nun trug sie eine metallene Haube, die an diesen Apparatus angeschlossen war, die die Universitas ihr geliehen hatte. Die besten Gelehrten unter der Sonne Heligonias hatten Tage damit zugebracht, die Maschine so weit zu modifizieren, daß sie in der Lage war, etwas größeres als einen Dolch als Fokus zu akzeptieren. Denn die Prinzessin hatte sich vehement gegen die Idee gewehrt, ihren Bruder als Proband an die Maschine anzuschließen. Ihrer Meinung nach war er zu schwach, um diese Prozedur zu überstehen.
Das Edikt ihres Vaters, des Fürsten, Schwarz zu tragen, hatte seine Tochter ernst genommen. Sie trat an ihren Apparatus, die ihren lieben Bruder konserviert hatte, heran und schaltete ihn ab. Mit einem leisen Aufflackern erloschen die schillernden Facetten, und der Prinz tat seit Wochen seinen ersten Atemzug.
Die Prinzessin legte selbst Hand an ihren Apparatus an, als man ihn vorsichtig in eine Ecke des Raumes schob, damit Platz für die Maschine der Universitas geschaffen wurde.
Die alte Poenahochgeweihte stellte die Verbindung zwischen den Probanden und dem Land, der Erde und der sie umgebenden Realität her. Ihr leises Gebet erfüllte den Raum. Die Hüterin des Schreins, in dem dies alles stattfand, hatte sich still schweigend in ihr Allerheiligstes zurückgezogen, um das Element des Wassers darum zu bitten, alles Böse von dem Geschehen abzuwenden.
Die Cousine der Prinzessin und des Prinzen, die Baronin dieses Landes, war beiseite getreten. Sie war keine Gelehrte, die die Gesetze der Magie verstand, doch war sie die Gastgeberin dieses heimlichen Spektakels. Niemand, fast niemand, außer den anwesenden Personen wußte davon, was hier gleich geschehen würde.
Einer der Gelehrten, ein Mann mit sehr feinen Gesichtszügen, die an das Antlitz eines Elfen erinnerten, hatte sich in einigem Abstand zu dem Projektionsrad der Maschine postiert. Er hatte vor, das Geschehen mithilfe dreier Siegilis aufzuzeichnen, damit man im Nachhinein alles Erträumte noch einmal genauestes untersuchen konnte. Seine hellblauen Augen musterten den Abstand seiner Position zu der Apparatur noch einmal genauestes. Und so, wie er mit schlafwandlerischer Sicherheit das Kommende vorbereitete, arbeiteten die anderen Gelehrten ebenfalls sehr gewissenhaft. Man hatte sicherlich hunderte Male durchgesprochen, wer welche Position einnehmen würde, damit ihnen kein einziger Fehler unterlaufe. Während nun ein schmaler, junger Mann mit blondem, gestutztem Bart und ein größerer in blauem Gewand die Ströme der Magie, die sie nun gleichwohl in Bewegung versetzen würden, mit geschultem und kritischem Auge überwachten, legte ein recht unscheinbarer Mann, ein Meister der Mechanik, den Hebel auf der schwarzen Grundfläche des Apparates um, die mit silberner Ornamentik verziert war. Es waren geschickt, von einer unbekannten Hand, magische Zeichen eingewebt worden, die nun leicht im Astralen Raum zu leuchten begannen. Der große Schirm, auf dem Träume abgebildet werden konnten, begann sich langsam zu drehen. Magie sammelte sich im Raum, sie floß aus der Erde empor und stieß gleichermaßen vom Himmel herab.
Drei weitere Gelehrte und die Prinzessin, die sich zur Dämpfung auf ihre Positionen um den Apparatus begeben hatten, wurden von dieser ersten Welle der Magie erfaßt. Sie durchdrang spielerisch die Körper der Menschen und floß vertraute Pfade der jeweiligen Begabungen. Sie waren alle unterschiedlich und doch vereinigten sie sich hier und jetzt für eine einzige Sache. Aus ihren Körpern floß dann die Magie, die Kraft dieser Welt, wieder hinaus, um sich wie ein Netz über den Raum zu spannen, um das Geschehen für die suchenden Augen gefährlicher magischer Anomalien unsichtbar erscheinen zu lassen.
Die Gemahlin fühlte sich aus der Realität gerissen. Etwas zog sie aus ihrem Körper hinaus in einen schwarzen Strudel, dem sie sich nicht entziehen konnte. Kurz drohte sie, in Panik auszubrechen, doch dann fühlte sie die Hand Poenas auf ihrer Schulter ruhen, die ihr Kraft gab und das Versprechen sicheren Geleits zurück in ihre Welt. Die alte Hochgeweihte saß zwischen den liegenden Körpern des Prinzen und seiner geliebten Gemahlin. Sie wachte über den Gesundheitszustand der beiden und würde im Falle von Schwierigkeiten sofort das Experiment unterbrechen.
Nebel umpeitschte sie, raste um sie herum, wie Wolken am Firmament, wenn der Sturm sie treibt. Kalte Blätter trug der schneidende Wind mit sich und fegte sie über eine düstere Moorlandschaft, die in ihrer Tristheit nur von knorrigen, dürren Baumresten durchbrochen wurde. Wie schwarze Mahnmale stachen sie als bleiche Knochenhände empor und winkten ihr starr zu, als sie das Reich der Lebenden verließ.
Ein Baum sog den Strudel der Blätter an, riß an ihren goldenen Haaren, zerrte an ihrem weißen Kleid, zerwühlte den schwarzen, kurzen Bart und biß schneidend durch die Reitkleidung. Weiter, weiter mußte er gehen, mußte zu dem schwarzen Baum, der dürr den ganzen Himmel auszufüllen schien. Dunkel gähnte das Auge, das Astloch, das ihn unheilvoll anstarrte. Der Wind blies immer stärker, und der Nebel wurde immer dichter. Weiß und gelb umwallte er ihn, ließ ihn erblinden und nur noch in den riesigen Baum starren.
Schwärze. Überall war es blendend weiß. Er fühlte nichts, Schwerelosigkeit und Hände, viel schwarze Hände, die nach ihm griffen, sich in seinen goldenen, langen Haaren verkrallten, an ihrem weißen, wallenden Gewand zerrten und sie letztendlich besiegten.
Nackt, verloren, verraten, allein stand sie nun da und um sie herum breitete sich das Schweigen laut in ihren Ohren aus.
Was war geschehen? Hallte die Frage in ihrem Kopf wieder.
Sie sollte doch etwas anderes hören, doch was war es? Es fehlte etwas? Doch was? Was?
Sie sollte etwas fühlen, doch was, was war es, das sie nicht vermißte?
Trommelwirbel durchdrangen die Stille der Nacht. Es war nebelig, und ein bleicher Mond schien zu ihr hinab. Sie konnte Bäume um sich herum erkennen und fühlte zu ihren Füßen feuchtes Gras. Der dumpfe Wirbel wurde lauter, und plötzlich kam Bewegung in den Nebel. Der Wind malte Muster hinein, so daß sie glaubte Gesichter und Wesen unbeschreiblicher Scheußlichkeit zu erkennen. Der Boden begann, leise im Takt des Trommelwirbels zu beben. Es erinnerte sie an etwas, das sie vergessen hatte. Was war es? Was hatte sie vergessen?
Die Erschütterungen des Bodens krochen ihr in die Waden, dann empor in ihre Kniekehlen und plötzlich sah sie sich zwei schwarzen, riesigen Pferden gegenüber, die sich in ihrem silberschweren Geschirr vor ihr aufbäumten und dann explosionsartig zum Stillstand kamen, als wären sie gemeißelte Statuen aus einem Alptraum. Der Boden hörte auf zu vibrieren, und der Nebel wich wie ein Vorhang katzbuckelnd zur Seite. Die schwarzen Rösser zogen einen Streitwagen, geschaffen aus der Nacht, flink und schnell, damit die Beute niemals entkommen konnte. Niemals! Ein bleiches, unmenschliches Gesicht starrte auf sie hernieder. Es war grauenerregend schön. Und als es sich herumdrehte, trug es das Antlitz eines Fuchses. Das Starren der schwarzen Augen dauerte ein ganzes Leben lang, Tod und Vernichtung lag in seinem Blick, und doch zögerte der schwarze Hüne. Das Gesicht beugte sich hinab und lächelte, beinahe freundlich, dann fühlte sie, wie sich ein leichter Umhang gleich schweren Fesseln auf ihre nackten Schultern legte.
Eine bleiche Hand in einem schwarzen Handschuh streckte sich nach ihr aus. Sie erschrak, doch war in ihm kein Zögern. Das Fühlen war Erleichterung, endlich das zu erhalten, wonach er sich immer gesehnt hatte. Was hatte er vergessen? Es sollte unwichtig werden. Er wollte vergessen, und das war gut so.
Blonde Haare waren das Banner gewesen. Doch wofür? Was fehlte ihm?
Diese Hand, diese Hand brannte sich unauslöschlich in seinen Verstand, sie war Versprechen, Verführung, sie war das Tor, sie war der Wind, sie war die Freiheit, sie war Fessel und entfesselnd zugleich.
Nichts in seinem Leben war wahrhaftiger gewesen als diese Hand, als er sie ergriff.
Er fühlte sich emporgehoben, hinauf in die grelle Nacht. Und dann knallte die Peitsche über den Rücken der Rösser, und die Räder setzten sich sprunghaft in Bewegung, drehten sich ohne Speichen um die Nabe, und der Wirbel gebar Muster, die sich ähnlich wie Luchnische Knoten, um die Gefährten wanden. Er wurde der Wind, er wurde der Trommelwirbel, der ihn hinfort nach Hause brachte. Das dumpfe Dröhnen, daß ihn in manch einer schweigenden Nacht begleitet hatte, das war das Meeresrauschen fern von den Ozeanen, wenn man sich dem Gaukelspiel einer ans Ohr gehaltenen Muschel hingab.
Was hatte er vergessen? Was hatte er verloren?
Es war egal.
Der Wind riß ihn mit, mit zur Jagd. Sein Verstand floh, seine Erinnerung geriet in Vergessenheit, es war nichts mehr wichtig, nur noch das Jetzt, zu sein.
Wirbel um Wirbel, bleichweiß umspielt der Nebel mit blätterscharfer, kalter Klinge die Beine der schwarzen, feuertragenden Rösser empor in die Erde, hinab in den glühendschwarzen Himmel. Peitschend die Wurzeln der Bäume, die ihnen lachend ins Gesicht schlugen, überall diese schwarzen Augen, kältebrennend vor Erregung des einzig und alleinigen Grundes, im Herzschlag zu leben. Das dumpfe Pochen der fliegenden, schweren Eisenhufe, wie sie sich in den Schoß der Mutter gruben, immer weiter wühlten sie sich hinein, bis man vergaß, daß man einst ein Herz getragen hat.
Sie konnte nicht einmal schreiend erwachen, sosehr hatte sie diese gefährliche Reise angestrengt. Blaß und beinahe so leblos, wie ihr Liebster lag sie auf der Bahre der Traummaschine. Langsam drehte sich das Rad der Projektion und blieb dann stehen. Der Astrale Raum flackerte kurz auf und erlosch zu dem leisen Glimmen, das überall gegenwärtig war. Nach Atem ringend ließen die vier Außenstehenden das Netz der Dämpfung fallen. Es war vollbracht.
Die Prinzessin befestigte mit leicht zitternden Fingern die Spiegelbrosche, die ihr als Fokus gedient hatte, wieder an ihrem Kleid. Gerade wollte sie die silbernen Klauen, die ihr in den letzten Monden bei dieser Art von Magie immer wuchsen, abwerfen, als mit einem dumpfen Knall die Tür in das Xurlheiligtum aufflog und gegen die Mauer prallte.
Sie alle schraken zusammen, und einige hatten schon mit dem Weben eines Abwehrzaubers begonnen, als man die Wappenröcken derer von Drachenhain erkannte.
Zwei großgewachsene Krieger postierten sich rechts und links der Tür, als der Fürst persönlich in den Raum gestürmt kam. Er sah schlecht aus. Seine Augen waren wie von langem Fieber eingefallen und tiefe Furchen hatten sich in das grau gewordene Gesicht gegraben. Der Zustand des Sohnes hatte beim Vater deutliche Spuren hinterlassen. Einzig und allein die verheerende Flamme der Wut brannte diese Zeichen der großen Sorge für einen Augenblick hinfort. Zornesfunkelnd füllte er, durch und durch ein Krieger, den Türrahmen aus. Er trug sein Kettenhemd mit der Leichtigkeit eines Leibchens. Darüber spannte sich ein ganz in Schwarz gehaltener Wappenrock aus Samt und fest gewobener Seide, das sein in schwarz gehaltenes Wappen trug. Die dunklen Locken, die er seiner Tochter vererbt hatte, waren zu einer kurzen nackenfreien Frisur geschnitten, und ein gestutzter, mit Silber durchwirkter Bart zierte sein breites Kinn.
Die Prinzessin spannte sich an. Diese Begegnung zwischen Vater und Tochter versprach großen, verheerenden Ärger.
Der Fürst starrte der Prinzessin direkt in die Seele. Seine blauen Augen entluden sich wie ein dunkles, böses Gewitter über seiner Tochter, als er zu ihr trat. Er war taub allen Beruhigungsversuchen ihm gegenüber, er hatte nur noch Augen für seinen Sohn und für den Verrat, den seine Tochter ausgeübt hatte. Ausdrücklich hatte er ihr verboten, Magie gegen den Prinzen einzusetzen, da er den begründeten Verdacht hatte, daß sie ihn aus dem Weg schaffen würde, um selbst des Vaters Erbe antreten zu können. Wie konnte seine Tochter den Einen nur derart verraten?
Wutentbrannt hob der Fürst sein vielgerühmtes Schwert. Er würde diesem schwarzen, gottlosen Treiben hier und jetzt ein Ende setzen. Dieses ruchlose Werk würde vernichtet werden.
Nie und nimmer würde die Prinzessin ihren Bruder dem verblendeten Vater überlassen. Magie war der einzige Weg, ihren Bruder zu retten. Warum nur konnte er sie nicht verstehen? Er würde den Prinzen töten! Es hatte sich doch gezeigt, daß die Gebete zu dem Einen unerhört geblieben waren!
Die entsetzten Zuschauer, die sich ob des Sturmes, der sich nun gleich in diesem Zimmer unter denen zu Drachenhain entladen würde, wichen zurück. Das war ihr Glück.
Der Fürst stob wie ein gereizter Stier durch den Raum und die von Statur aus eher kleine Prinzessin stellte sich ihm wütend und verzweifelt in den Weg.
Die Schwester würde das Leben ihres Bruders mit allen Mitteln verteidigen. Fast ohne ihr Zutun hob sie die schwarz behandschuhten Hände, die immer noch die Silberkrallen trugen. Entfesselt von Angst und Wut stoben aus ihren Fingerspitzen unsichtbare Kräfte, die sich vor ihr ballten wie ein Kugelblitz. Die Entladung traf den Fürsten direkt vor der Brust und warf ihn gerade mal einen Schritt zurück. Es geschah alles furchtbar schnell. Die Prinzessin fühlte Entsetzten ob ihrer Tat in sich aufkeimen, vielleicht ein leises Wundern, daß sich ihr Angriff in leises Wohlgefallen aufgelöst hatte, als sie der Knauf des väterlichen Schwertes mitten ins Gesicht traf. Schwärze kroch ihr explosionsartig ins Gebein und schleuderte ihren Geist weit, weit fort.
Unbeschreiblich langsam fiel der kraftlose Leib der Prinzessin zu Boden.
Stille herrschte nun im Xurlheiligtum! Kurzweilig schien es so, als wolle der Vater die ohnmächtige Tochter im Fallen aufhalten. Er machte dazu eine hastige Bewegung nach vorn, dann aber verharrte er in seinem Vorhaben, schloß für einen Moment die Augen und wandte sich schließlich mit entschlossener Miene seinen Soldaten zu: „Verschafft mir Platz unter diesem Gesindel! Wir bringen ihn nach Hause!“
Auf diesen knappen Befehl hin gelangte mit einem Mal Bewegung in die Männer, die ihren Herrn hierher begleitet hatten. Die Anwesenden wurden von ihnen grob und ohne Rücksicht an die Wand der kleinen Kammer gepreßt. Kein Protestieren half – zu schnell ging alles vonstatten. Einzig gegen seine Nichte, die Baronin, und der Gemahlin seines Sohnes wagte keiner die Hand zu erheben, diese postierten sich nun vor dem Bett, in dem still und ahnungslos der Prinz lag, standen gleich einer Einheit zwischen ihm und dessen Vater. Dieser schritt den beiden Frauen energisch entgegen, machte nur eine Handbreit vor ihnen Halt und blickte ihnen abwechselnd tief in die vor Zorn geweiteten Augen. Seine Stimme war rau und brüchig: „Macht Platz! Oder wollt etwa auch Ihr Bekanntschaft mit dem Schwert meiner Väter machen? Wisset: Wer sich mir entgegenstellt, wird es bereuen. Ich warne nur euch EINMAL!“
„Nein Onkel, tut dies nicht“, entgegnete die Baronin beherzt, aber mit hörbar bebender Stimme, „er wird mit Sicherheit sterben, wenn DU ihn mit dir nimmst! Wenn mein Wort in deinem Herzen Gewicht hat, dann lasse ihn hier. Wir vermögen ihn wieder zurückzuholen, Onkel!“
Doch der Stier von Drachenhain war taub für die Worte seiner Nichte: „NEIN! Besser Tod denn ein Leben lange Dienerschaft dem Bösen!“
Auch die Gemahlin, eng an der Seite der Baronin, widerstand den finsteren Blicken des Fürsten. Doch letztlich wurde auch ihr die Sinnlosigkeit ihrer Anstrengung bewußt, und sie sprach bitter: „Tut, was Ihr wollt. Aber wenn er stirbt, seid Ihr mein Feind, Fürst!“
Mit Zornesröte auf den Wangen und vor unbändiger Entrüstung am ganzen Leibe zitternd, wichen die Frauen zur Seite. Der Fürst bahnte sich ohne Rücksicht den Weg zu seinem Sohn frei, kappte mit einem Ruck die Schläuche und Schnallen, die Mensch mit Maschine verband, hinfort und trug seinen Sohn unter großer Anstrengung eigenhändig davon. Doch noch bevor der Fürst diesen Raum verließ, wandte er sich noch einmal um und schaute jedem der anwesenden Frauen und Männer vorwurfsvoll ins Gesicht, und es schien, als wolle er sich das Antlitz eines jeden Menschen merken.
Tödliche Stille kehrte mit dem Verschwinden derer von Drachenhain in den gemauerten Raum ein. Die Bewegung der Poenahochgeweihten war das erste, das den Bann des Entsetzen, des hilflosen Zorns, der sich in manch einem Herzen eingenistet hatte, durchbrach. Sie eilte zu der bewußtlos darniederliegenden Prinzessin, der Blut von der aufgeplatzten Wunde an der Wange über das Gesicht lief. Einige Bedienstete, die die Baronin zu sich holte, brachten den leblosen Körper fort, damit die Poenahochgeweihten sich in aller Ruhe um die Verletzung kümmern konnten.
Zurück blieben die Gelehrten und die goldhäuptige Gemahlin des Prinzen, die ihre Wut ob ihrer Hilflosigkeit zu bändigen wußte. Mit bleichen Gesicht stand sie inmitten des Heiligtums und versuchte, sich darüber klar zu werden, was soeben geschehen war.
Einige Gelehrten begannen leise damit, den Apparatus zu untersuchen. Schließlich war er ein kostbares Gerät, und nur eine Leihgabe der Universitas. Man fand Beschädigungen an der Liege und dem Helm, der verbeult und von allen Drähten abgetrennt in einer Ecke lag.
Man wollte den Schaden gemeinsam beheben, doch der Gesandte der Universitas stellte sich dagegen. Er wollte alle Teile, so wie sie waren, sofort einpacken und mit sich nehmen. Sein Wunsch wurde ihm gewährt.
Das erste, an das sie sich erinnerte, war das Gesicht der alten Poenahochgeweihten, die ihr ein feuchtes Tuch an die Lippen führte, dann hüllte sie wieder Dunkelheit ein wie ein vergessenbringendes Leichentuch.
Ja, Vergessen war das Privileg der Schlafenden und Toten. Doch die Prinzessin war am Leben. Das riefen ihr die peinigenden Schmerzen ins Bewußtsein, als sie sich langsam von ihrer Verletzung erholte.
Das Gesicht war angeschwollen, so daß sie glaubte, daß sich das Fleisch durch die Poren ihrer Haut quetschen wollte. Sie konnte nicht sprechen, weil dann ihre Lippen aufplatzten und der Schmerz ihren Verstand zu rauben drohte. Nie hatte sie gelernt, Heilzauber zu wirken, sie war, stolz nun eine Magierin zu sein, von ihrem Lehrmeister davongelaufen, bevor sie es lernen konnte. Vielleicht hätte sie die Geduld aufbringen sollen, ihre Ausbildung zu beenden.
Zu den Schmerzen gesellten sich ihre Gedanken, die Sorge um ihren Bruder und der Haß auf ihren Vater. Der Haß war so heiß und reinigend, daß er die leisen Selbstvorwürfe, sie verschulde diese Situation, einfach hinwegbrannten. Warum nur hatte sie ihren Bruder nicht vor der Dummheit ihres Vaters retten können? Warum war die Magie an ihrem Vater einfach so abgeprallt?
Eine leise Stimme flüsterte in ihrem Geist: Von irgendwem mußt du ja deine Begabung geerbt haben, ebenso wie deinen sturen Kopf.
Der Gedanke an ihren Bruder und dass die Geschichte erst ihren Anfang gefunden hatte, ließ sie unter den mahnenden Augen der Poenageweihten aufstehen und eine Versammlung der Gelehrten auf der Burg einberufen.