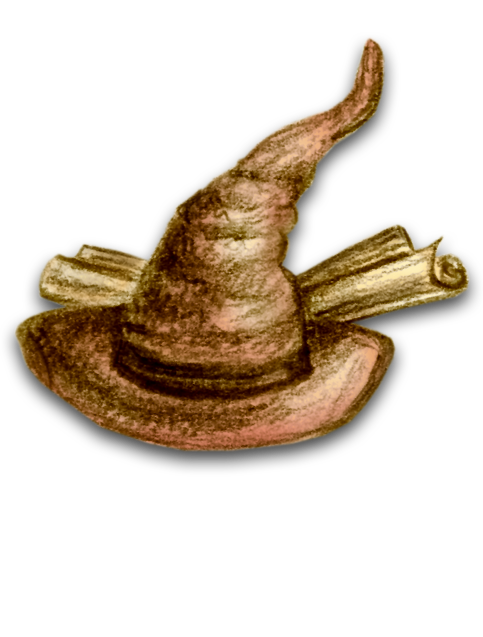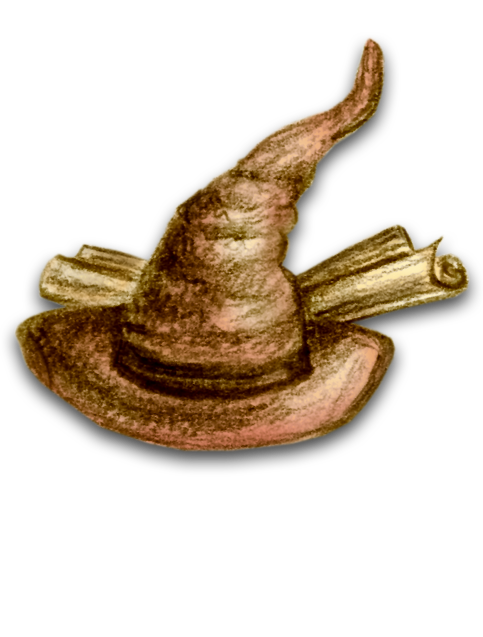Die Flucht im Kastenwagen
Wahrlich ungemütlich war es in der Kutsche, die rasante Fahrt auf holpriger Straße ließ das schwere Gefährt alle Nas` lang bockig aufspringen und dann wieder, einhergehend lauten Krachen, Haftung zum Boden finden. Das Schaukeln war schier unerträglich. Ebenso war es im Innern derart heiß, dass man meinen konnte, Helios selbst säße, anstatt des braven Bronu, auf dem Kutschbock. Fenster – wie in diesen modernen Betiser Kutschen – gab es nicht, lediglich ein paar schmale Ritzen sorgten für spärlichen Lufthauch.
Trotz alledem, der einzige Passagier innerhalb des Wagens fror! Er fror sogar unmäßig, so zitterte er am ganzen Leib, obwohl er in schwere Decken und Felle gehüllt und seit Stunden fast regungslos da saß. Überhaupt sah dieser Mann recht mitgenommen aus, aus tiefen Höhlen, starrten nervös blinzelnd, rotunterlaufende Augen hervor. Der Atem ging schwer und giemend. Fahrig spielten die Hände mit dem zinnenen Becher, aus dem er soeben den letzten Schluck eines warmen Trunkes genommen hatte, der aber keinerlei Erquickung brachte.
Mit einem Mal gewahrte der Mann, dass die Beschleunigung nachließ, da erhob er sich mühsam, drehte den Becher mit zorniger Miene in seiner Hand und schlug mit dem Boden schwer an das Kutschendach über ihm und rief so laut, wie seine brüchige Stimme es ihm erlaubte: „Heda Bronu, treibe er seine Schindmähren an. Wir wollen nicht von unserem Häschern eingeholt werden. Eile er sich also, wenn ihm sein Leben lieb und teuer ist!“ Beschwerlich nahm der Erzürnte wieder Platz, beruhigte sich jedoch weder, als er bemerkte, dass seinem Befehl sofort Rechnung getragen wurde, noch als er ein wenig Halbschlaf erfuhr. Denn er war ungeduldig, er hatte zwar viel Wegstrecke hinter sich gebracht, jedoch lag eine noch ausgedehnterer Entfernung vor ihm – weiter noch, als sich irgend jemand vorstellen konnte…
„Ob sie mich so wohl aufnehmen wird?“ fragte er sich im Stillen „So viel Zeit ist vergangen, so viel geschehen. Wird sie mich überhaupt erkennen, geschweige denn wollen – so wie ich jetzt aussehe?“ Langsam und müde hob der Mann seinen Arm und griff mit seinen, wie große langbeinige Spinnen wirkenden, Händen nach einem fast blinden Kupferspiegel aus dem Lederranzen neben sich. „Wer bist Du?“ befragte der Mann sein eigenes Bildnis mit lauter Stimme „Bist DU Leomar?“…
Schlummer
Es geschah in einer dieser schwülen Sommernächte im Erntemond, da wurde Ceridian Aegidio höchst unsanft durch panisches Gezeter, gepaart mit heftigem Glockengeläut, aus seinem kurzen Schlummer geweckt. Der Bischof des Fürstentums Drachenhain hatte sich, nach beendetem Gebet, bereitwillig und in noch kniender Position, in den sanften Schlaf begeben, denn das Warten war seine Sache nicht. „Bischof, Bischof“ jemand zerrte nun an ihm „Ihr sagtet, ich solle euch rufen wenn, wenn, wenn…“ die Stimme erstarb in einem tränenersticktem Seufzer. Der Greis reckte und streckte mühsam seine knarrenden Glieder und nahm die bereitgestreckte feiste Hand beim Aufstehen zur Stütze. Oh, wie gern wäre er einfach zurückgesunken in dieses tiefe, süße Schläfchen. Doch weder der fürstliche Leibdiener Kuhmundus vor ihm, noch das unmäßige Geläut der Drachentrutzer Glocken, ließen diese bequemste aller Möglichkeiten zu. Mit dem Erwachen kehrte, gleich dunkler Schatten, nach und nach auch die Erinnerungen zurück. Die Erinnerungen daran, zu welchen Umständen die Glocken läuten und der dicke Kuhmundus ihn rufen sollte, schließlich hatte er selbst dies so angeordnet – die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitzschlag: „Leomar stirbt!“
Mit einer Behändigkeit, die den Leibdiener in wahres Staunen versetzte, kleidete sich der höchste ceridische Priester des Fürstentums in bischöfliches Ornat, langte nach Rauchfass nebst Olibanum und machte sich sogleich eilenden Schrittes auf den Weg zum Palas der Drachentrutz, wo er wohl erwartet wurde. Weit hatte er nicht zu gehen, denn Richilesruh, das Klosterstift der Feste, in das er erst seit einigen Stunden einquartiert worden war, lag in unmittelbarer Nähe zur Festungsburg des Fürsten Waldemar von Drachenhain. Das Gotteshaus, sowie all seine Kammern und Gänge, waren ihm alles andere als unbekannt, schließlich hatte er vor mehreren Dekaden an deren Planung und Erbauung mitgewirkt und als Priester der Drachenhainer Herrscherfamilie lange Zeit darin gelebt. Erst die Berufung zum Abt des Landes St. Aluin durch den Fürsten von Drachenhain vor zwei, und die spätere Erwählung zum ceridischen Bischof des Fürstentums Drachenhain im vergangenen Jahr, durch den neuen Primus geschehen, führten den alten Mann doch noch zu neuen Aufgaben und neuen Ufern.
Der Weg zur Heimstatt der Drachenhainer Familie war ihm also mehr als bekannt. Und so drängten sich dem Bischof in dieser ihm vertrauten Umgebung allerhand Bilder aus der Vergangenheit auf. Der Bischof erinnerte sich an die Taufen der beiden Drachenhainer Kinder, Syria und später dann Leomar – neben dem Eheschließen – hatte er diese Segnungen stets am liebsten getan. Ein Lächeln umspielte für einen Augenblick seine Lippen, dann aber erstarb dieses, als ihm wieder bewusst wurde, dass nun wohl für den jüngsten Sohn des Fürsten nach langer Krankheit der Kreis des Lebens geschlossen werden würde. „Wasser öffnet und Öl schließt den Bund zum Einen“, pflegte er immer zu sagen. Doch wie wenig trafen diese Worte auf Leomar zu, der schon vor Jahren und aus freien Stücken, den strahlenden Weg des Einen verlassen und sich dem Ogedentume zugewandt hatte. Auch seine Schwester, Prinzessin Syria Jaldis, ist im Grunde keine Ceridin mehr, im Wonnemond war sie wegen ihrer unceridischen Handlungen von ihm selbst exkommuniziert worden. Ein stechender Schmerz machte sich in der Brust des alten Mannes breit, stets hatte er sich Vorwürfe deswegen gemacht. Wie dem auch sei, Leomar ist – ob er will oder nicht – getaufter Ceride und soll nach dem Willen das Fürsten auch entsprechende Verabschiedung von der Welt der Lebenden erhalten.
Oh, wie traurig war nur dieser Tag und welch betrübliche Aufgabe lag noch vor ihm: „Warum Prinz wolltest Du nicht gesund werden? Warum nur, musst nun Du im Sterben liegen, so jung, wie Du bist?“ rief er aufs Geradewohl in die schwüle Welt hinaus. Zu seiner Verwunderung erhielt er umgehend Antwort: „Geht es Euch übel, Herr Bischof? Kann etwas für Euch tun?“ erkundigte sich die atemlose Stimme des Kuhmundus hinter ihm. Der Leibdiener war Ceridian Aegidio wohl so pflichtbeflissen wie leise gefolgt. „Nein, nein mein Sohn. ICH benötig keinen Beistand. So du jedoch tatsächlich in einer Weise dienlich sein willst, dann schicke für deinen jungen Herrn ein Stoßgebet zu allen Heiligen. Auf dass von dort oben vielleicht noch einmal Unterstützung komme!“
Der Bischof war inzwischen am Burgtor angelangt. Misstrauische Äuglein auf der anderen Seite des Gucklochs verengten sich kurz, weiteten sich aber schließlich vor Schreck und Ehrfurcht binnen Sekunden und Ceridian Aegidio wurde, nebst Kuhmundus, umgehend durch die kleine Türe im Burgtor eingelassen.
Bereits hier am Eingang konnte er das Heulen und Klagen der Weiber vernehmen, die wohl in der Küche beieinander saßen, um den jungen Herrn zu betrauern, anstatt ihrem Herrn jetzt zur Hand zu gehen. War er zu spät gekommen? War Prinz Leomar bereits tot?
So schnell er vermochte humpelte der Bischof durch die weiten Gänge bis hin zum großen Kaminzimmer entlang. Dann endlich gelangte Ceridian Aegidio an die neue stählerne Tür, holte noch einmal tief Luft, raffte sein Gewand und trat ein.
Inmitten des großen, fackelerhellten Raumes war das Bett des Prinzen von Drachenhain aufgestellt, dicke Felle und volle Daunendecken sollten ihn vor der Kälte schützen. Leomar lag nur still da, die Augen geschlossen. Der Anblick hatte sich seit seinem letzten Besuch am Morgen nicht verändert, oder doch? Ihm schien als atme der Prinz auf andere Weise. Schnappte er nicht richtiggehend nach Luft? Der Bischof hatte lange genug Menschen in ihrer letzten Stunde gepflegt, um zu wissen, das dies Anzeichen des nahen Todes waren. Mühsam hob und senkte sich der dünn gewordene Brustkorb und pfeifend bliesen die schorfigen Lippen letzten Lebenshauch ein und aus.
Der alte Mann schluckte schwer, sein Hals fühlte sich so trocken, wie noch nie in seinem lange Leben an. Bei allen Heiligen, das dürfte doch nicht wahr sein! Reiß dich zusammen, alter Narr, du wirst gebraucht! sagte Ceridian Aegidio zu sich selbst und fasste sich ein Herz: „Waldemar, alter Begleiter. Erlaubt mir von Eurem Sohn Abschied zu nehmen und ihm die letzte Ehre zu erweisen!“ Der Bischof hatte sanft aber vernehmlich gesprochen, dennoch rührte sich die Gestalt des Fürsten, der in tiefer Trauer vor der Bahre kniete, nicht. Ceridian Aegidio trat ohne eine Antwort abzuwarten ins Zimmer, auf den augenscheinlich sterbenden Prinzen von Drachenhain zu.
Die Suche
Es war windstill. Ein merkwürdiger Augenblick in der weiten Tiefebene. Normalerweise wurden die knorrigen schwarzen Bäume, die vereinzelt Wurzeln in der moorige Landschaft geschlagen hatten, vom Wind derart drangsaliert, dass sie schon die Gestalt alter gebeugter Vetteln angenommen hatten. Der bleierne Himmel fand in vielen stillen Tümpeln und Weihern ein Spiegelbild seiner selbst und um die Anmut düstererer Tristheit noch zu vervollkommnen hingen wie vergessene Spinnenweben Nebelfetzen klebrig in den Büscheln hoher blasser Gräser.
Es war ein Augenblick vollkommener Ruhe und Stille.
Diese Erfahrung nach all dem Aufruhr zu machen, war fremd und beunruhigend. Sie wollte das beklemmende Schweigen mit ihrer Stimme durchbrechen, wollte irgendetwas zu der Frau neben sich sagen, nur damit sie wieder das Gefühl ihrer eigenen Existenz zurückerlangte. Ein Finger legte sich auf ihre Lippen und gebot ihr Still zu halten und da begriff sie, wie kostbar dieses Schweigen der Welt war und sie ließ sich nun ohne Argwohn hineintreiben. Sie beruhigte ihre Gedanken auf ein Maß hinunter, dass sie ihr nicht mehr vorhanden schienen. Dieses Glück vollkommener Ruhe sollte aber nur kurz währen, denn ein Rabe glitt auf leisen Schwingen zu einem der näher gelegenen schwarzen Bäumen und ließ sich in dessen blattlosen Krone nieder. Sofort kehrten ihre Gedanken lauthals wieder zurück. Da waren Erinnerungsfetzen an das Treffen der Gelehrten, welche die verwirrenden Bilder der Traummaschine deuteten. Der Luchnische Knoten war aufgetaucht und nach einer langen Diskussion hatte man sich darauf geeinigt, dass die Seele des Prinzen wohl in der Anderswelt zu finden sei.
Da war der Schmerz des väterlichen Verrats; sein Schwert, das nicht nur ihr Gesicht zerstörte, sondern auch das Vertrauen zu ihm.
Da waren sorgenvolle Stimmen, die auf sie einredeten, dass sie sich schonen und ausruhen müsse.
Da war die väterliche Hand, die sich ihr aus feiger sicherer Ferne wie eine Klaue genähert und ihr das ceridische Kreuz der geliebten Mutter vom Hals gerissen hatte.
Da war die lange zermürbende Reise durch den tauenden Winter in den kalten Frühling hinein nach Luchnar. Da waren die entsetzten Blicke der Adeligen, die sie aufsuchte, ob ihres derangierten Äußeren.
Da waren so viele gute und schlechte Ratschläge. Da war die Frustration, dass sie auf keinen Druidh getroffen war. Denn sie stellten ihr letzte Hoffnung dar, das Geheimnis um ihren Bruder zu lösen. Man hatte ihr bedauernd mitgeteilt, dass sich die Druidhs um die akuten Probleme des Landes kümmern mussten und deswegen gegangen waren. Wohin, dass hatte man ihr natürlich nicht sagen können.
Und da war plötzlich die Rabenfrau an ihre Seite getreten. Sie brachte Stille und Einsicht in ihren laut hallenden Geist. Rabe, der Götterbote, hatte sie zur rechten Zeit an den rechten Ort geführt.
Prinzessin Syria riss ihren Blick von der luchnischen Moorlandschaft los und betrachtete sich eingehend ihre Reisegefährtin. Sie hatte diese Frau vor einigen Monaten auf Schloss Idyllie kennen gelernt, als sie ihre geraubte Rabenmaske, nebst der Diebe einforderte. Anagok, die Schamanin der Apulaq-Taq, stand aufrecht neben der Prinzessin und hatte ihre klaren Augen in die Stille hinein gerichtet. Seltsame schwarze Tätowierungen zogen sich von ihrem Scheitel über den geraden Nasenrücken hinab bis zu ihrem Kinn. Die Augenhöhlen hatte sie mit einem Gemisch auf Kohle und Fett dunkel gefärbt. Die Anagok war von eher schlankem Wuchs und doch strahlte sie eine Größe aus, die manch einen Baron klein und unscheinbar neben ihr erscheinen ließ. Syrias Gedanken schweiften ganz kurz zu ihrem Vater und wie von selbst rückte der kleine bohrende Schmerz in ihrem Herzen für diesen Augenblick in den Vordergrund. Als Syria den Blick aus ihrem Inneren wieder hinaus in die Welt richtete, schrak sie ein wenig zusammen, denn sie blickte in die weite Ferne der hellen Augen der Rabenschamanin. Sie hatte ein unglaubliches Gespür für Schicksale und von ihm hervorgerufene Gefühlsregungen und so öffnete sie den Mund und sagte etwas in der Sprache der Apulaq-Taq. Allerdings konnte es die Prinzessin nicht verstehen und doch wusste sie instinktiv, was die Schamanin meinte. Vielleicht reagierte ihr verschüttetes Erbe auf diese Form der Sprache?
Prinzessin Syria wendete eine ihrer Übungen an, um ihre innere Ruhe wieder herzustellen. Zufrieden nickte die Apulaq-Taq und richtete ihre Augen wieder auf die Landschaft.
Hier würde sich etwas ereignen, dass für die Suche von Wichtigkeit war.
In einiger Entfernung schlängelte sich träge das Band eines breiteren Baches durch das Moor und dort an dessen Ufer entdeckten sie eine Bewegung. Bei genauerer Betrachtung waren es sogar zwei.
Die eine Bewegung wurde von einem Wesen hervorgerufen, das sich die ganze Zeit über im Schatten einer Trauerweide verborgen hatte und nun auf breiten Tatzen am Ufersaum entlang trottete. Es trug einen dicken schwarzen Pelz am Körper und gemahnte an einen kleinen Bären mit einem mächtig langen Schwanz an seinem Hinterteil. Als sich dann das Wesen aufrichtete, konnte man ein fast menschliches Gesicht statt der langen Schnauze erkennen. Ein breiter Gurt, der ein Schwert auf dem Rücken des Wesens hielt, war die einzige Bekleidung des Gesellen. Ruhig schaute sich der Schwarzschwanzleberling, wie ihn die Anagok flüsternd bezeichnete, um und trottete dann wieder auf allen vieren unbekümmert am Ufersaum entlang, als sich die zweite Bewegung rührte. Es war ein Menschenmann, soweit man das über die Entfernung her erkennen konnte, der aus seinem Versteck hervorkam und sich dem viel größerem Bärenwesen in den Weg stellte. Syria fühlte, wie sich die magischen Kräfte der Natur hoben, sie kurzzeitig umspielten und dann, zu dem Mann flossen, der einige Gesten mit den Händen vollführte. Das Wesen verengte seinen milchigweißen Augen zu Schlitzen und entblößte fauchend scharfe Reißzähne. Vor Wut schnaubend richtete es sich auf, dann griff es zu seinem Breitschwert, zog es und stürzte sich mit einer Geschwindigkeit auf den Mann, die nichts gutes Erahnen ließ. Doch die flink geführte Klinge, die für die Beobachter zu einem wirbelnden Silberkreis geworden war, traf nie ihr Ziel. Stattdessen wurde nun der Schwarzschwanzlerberling von den Kräften der Natur gepackt und in die Dunkelheit, aus der es hervorgekrochen war zurückgeschleudert. Augenblicke später war alles wieder still. Selbst die herbeigerufene Magie ruhte wieder friedlich, wie der träge dahinfließende Bach. Die Prinzessin, die die Luft angehalten hatte, stieß sie zwischen den Zähnen wieder aus. Sie wusste zwar nicht, was sie gesehen hatte, aber sie erkannte nun in dem Mann einen der Druidh wieder. Das war ihr gottgewolltes Schicksal, dass sie nun endlich einen Wissenden über das Tor in die Anderswelt befragen konnte. Sie hatte kaum diesen Wunsch in ihren Gedanken geformt, als sich die Hand der Rabenschamanin auf ihre Schulter legte. Ihre Berührung sprach davon, dass es noch nicht an der Zeit sei. Lebhaft erinnerte sich Syria an den Moment, als die Druidhs sie ob ihres Glaubens an die Ceridische Kirche, des Landes verwiesen hatten. Aber das schien schon Jahrhunderte her zu sein. Denn heute gehörte sie, dank ihres Vaters, keiner Konfession mehr an. Und dennoch, wenn diese Kunde diesen Mann dort nicht erreicht hatte, und er in ihr die Prinzessin aus Drachenhain erkannte, dann würde ihn das Misstrauen derart überwältigen, dass er ihr sicherlich nicht den Weg in die Anderswelt zeigen würde. Aber, worauf warteten sie eigentlich noch?
Der Druidh blickte noch einmal hochkonzentriert, so schien es, in die Dunkelheit hinein, welche die Trauerweide in seiner Nähe durch die Form ihrer Krone entstehen ließ. Und da hob sich eine weißschäumende Welle aus dem Bachbett empor, wie es eigentlich nur ein Fluss hervorzubringen vermochte. Ein leichenfahles mächtiges Kaltblut sprang mit donnernden Hufen vor den überraschten Mann. Mächtige Arme sprossen dem unförmigen Pferd aus der Brust und griffen nach dem Druidh.
„Kelpie“, sagte die Anagok.
„Es war eine Falle“, flüsterte die Prinzessin. Und dann erkannte sie den Wink des Schicksals. Wenn sie den Druidh das Leben retten konnte … sollte man meinen, dass er ihr ein wenig Dankbarkeit zeigen würde. Das fahle Kelpie mit grünschimmernden Bachalgen anstelle einer fließenden Mähne trug die Absicht, den Druidh im Wasser zu ertränken.
Die Prinzessin schmiedete eine Trense aus dem Gewebe der alten Magie, die sie hier wild und frei umspielte. Eine Windböe fegte über das Moor, ergriff die beiden Menschenfrauen und brachte sie wie auf Rabenschwingen bis hin zu den Kämpfenden. Das Element der Luft und das der Magie waren die Fessel, die sich schleunigst um den Kopf des Andersweltrosses wanden. Das Wesen bäumte sich auf und warf den Kopf unwillig hin und her, doch konnte es die Trense, die es nun an den Erschaffer band, nicht abstreifen. Auf dem Kelpie lag nun ein Bann, der es in den Gehorsam der Prinzessin zwang.
Wutschnaubend blieb das Ross nun mit allen vier Hufen auf dem festen Ufersaum stehen und rollte mit den blassgrünen Augen.
Triefendnass rappelte sich der Druidh im Bachbett auf und betrachtete sich die Gesellschaft, die ihm das Leben gerettet hatte.
Die Prinzessin reichte ihm die Hand, die er zögern ergriff. Misstrauen war ihm ins Gesicht geschrieben, als er sich seine beiden Retterinnen besah. Narrende Trugbilder, die es in diesen Zeiten überall in Luchnar gab, scheinen diese beiden Frauen allerdings nicht zu sein.
„Ich bin eine Suchende“, sagte die Prinzessin.
„Was sucht Ihr denn?“ fragte der Druidh.
„Die Seele meines Bruders.“
Nun dämmerte es dem Druidh, wer da vor ihm stand. Sein Misstrauen loderte wild auf. Sie, eine Ceridin, bat ihn, einen Druidh, um Hilfe?! Sie stand unter dem Schutz der Weltlichen Macht Luchnars, doch nicht im Einverständnis der Druidhs. Und da kam dem Mann noch ein Gedanke, warum war die Prinzessin ausgerechnet eben jetzt an diesem Ort, um ihm das Leben zu retten? Das roch doch nahezu nach einem eingefädelten Plan.
Da richteten sich die blassen Augen der Schamanin auf ihn und sie sagte nur ein Wort, doch überzeugte es ihn: „Rabe.“
Der Frettchenreiter
Wieder schien der Wagen an Fahrt zu verlieren, doch allein ein Klopfen des Mannes mit Namen und Titel Prinz Leomar von Drachenhain genügte, um den Kutscher zum Gehorsam zu bewegen. Das Gefährt sprang daraufhin unmäßiger denn je. Das Holz knarrte bedrohlich. Die holpernden Geräusche und unsteten Bewegung riefen in Leomar fast vergessene Erinnerungen wach. So schossen ihm fremde bizzare Bilder von einem vermaledeiten Streitwagen und von verwunderlichen Fahrten über Stock und Stein in den Kopf. Er spürte förmlich Bogen, nebst Pfeilen, in der Hand und Stoßspeer unter dem Arme ruhen – was waren das nur für Visionen? Mehr und mehr wich der schwarzer Schleier von seinem Sinn, und er sah endlich klarer. Mit der aufgehenden Erkenntnis, wuchs jedoch auch noch etwas anderes, etwas dunkles und gleichzeitig schmerzendes in ihm. Dieses Etwas erstarkte im selben Maße, wie das Vergessen verflog. Rasende Kopfschmerzen hämmerten mit einem mal auf Leomar ein, so stark dass er die Augen schließen musste. Als er sie wieder öffnete, fand er die Umgebung vollkommen verwandelt.
So saß er nun nicht mehr im engen stickigen Kastenwagen, sondern stand in einer einspännigen Kutsche. Vor ihm lenkte ein kleiner Kerl in geckenhaftem Rock das Gefährt. Dunkles Blut troff von seinen Händen. Der kleine Mann stand mit dem Rücken zu ihm und so sah Leomar lediglich seinen pelzigen Hinterkopf. Den Prinzen packte das kalte Grauen. Was war nur mit Bronu, seinem Kutscher, geschehen. Hatte dieses seltsame Wesen ihn getötet, und war das Blut an seinen Händen am Ende das des armen Bronu? Leomar verlangte es nach Klarheit und so fasste er vorsichtig nach dem Burschen vor ihm. Nur eine noch Handbreit und er konnte den wilden Schopf berühren, da wandte sich das Wesen mit einem Mal um. Der Prinz starrte erschrocken in das spitze Gesicht eines Frettchens, das nun mit seinen scharfen Zähnen nach ihm schnappte. Vor Schreck und Entsetzen wich Leomar zurück und stieß mit dem Kopf schwer gegen die plötzlich wieder vorhanden Rückwand des Kastenwagens. Mit Erleichterung erkannte er, dass er sich wieder auf seiner Flucht befand und sank erschöpft danieder.
Der Kampf im Spiegel
Der Druidh hatte sie durch das Moor geführt. Wind war aufgekommen und hatte die Spiegel des Himmels zerstört. Immer wütender und Kälte mit sich führend fegte er über die Seen und Tümpel. Wellen kräuselten sich, zerstörten die Spiegel, die wie Tore in die Anderswelt anmuteten. Immer tiefer mussten sie in das Reich der Andersweltwesen eindringen, die in der heutigen Zeit, immer mehr Luchnisches Land für sich und ihr unmenschliches Treiben beanspruchten. Sie hatten einen Baum erspäht, ebenso von dunklem Holz, wie die anderen, der mit seinem Stamm derart vom Jahrzehntelangen Wind gebeugt ein Cairn bildete, einen Tor in die Anderswelt. Doch war, kurz bevor die Schamanin ihren Weg antreten konnte, ein Blitz vom Himmel gefahren und hatte den Baum in lodernde Flammen aufgehen lassen.
Irgendwer wusste, dass sie da waren und dieser jemand beanspruchte Leomars Seele für sich.
„Es ist nicht ganz so, wie Ihr denkt, Prinzessin aus Drachenhain, niemand kann die Cairns zerstören“, sagte der Druidh, „nur können wir diesen hier nicht durchschreiten. Das Land zeigt uns deutlich, dass Gefahr auf der anderen Seite lauert.“
Der Wind erhob sich weiter und gebar einen Sturm, der unbarmherzig über die Ebene fegte. Seine kalten Finger rissen an den Umhängen, in die sich die drei Menschen gehüllt hatten, doch berührte er das fahle Pferd, dass ihnen grimmig die Zähne gefletscht folgte, nicht im geringsten.
Aus aufkommendem Nebel, der sich wie eine Quellwolke von der linken Seite her auftürmte, stürmten Luchna hervor. Es waren um die zehn Männer, die wohl zur Jagd gerüstet waren. Sie riefen einander etwas zu und verschwanden dann zur rechten Hand wieder im Unterholz, ohne die Fremden eines Blickes zu würdigen. Der Prinzessin war etwas aufgefallen und sie rief dem Druidh eine Frage zu: „Wer von den Clans trägt Braun?“ Schweigen antwortete ihr.
Da trat eine großgewachsene Gestalt aus dem Nebel hervor. Er trug eine schwarze allesverhüllende Rüstung. Sie kannte ihn nur zu gut, denn er war einmal der erste Ritter von Tatzelfels gewesen. Cawadoc trat an sie heran und sein brennender Blick bohrte sich in ihre Augen. Dann drehte er sich herum und ging. Die Prinzessin erkannte im dichter werdenden Nebel, dass er die Hände hob und sich langsam des Helmes entledigte. Er wollte sein Geheimnis vor ihr lüften und dafür musste sie ihm folgen.
Der Wind riss wieder an ihrem Mantel, als eine Hand sie an der Schulter berührte. Der Nebel war augenblicklich verflogen und mit ihm Cawadoc und sein Geheimnis, dass sie fast gelüftet hätte. Vor ihr Gähnte eine Spalte, die sich tief ins Erdinnere grub. Hätte sie noch einen Schritt gewagt, dann wäre sie in den sicheren Tod gestürzt.
„Wir sind Nahe der Anderswelt“, rief der Druidh über den laut heulenden Sturm, der ein wenig enttäuscht darüber klang, dass ihm seine Beute entkommen war. „Leider bedeutet das aber nicht, dass hier ein Tor zu finden ist. Wir müssen weiter.“ Der Druidh führte sie eine geraume Weile an der Schlucht entlang, bis sie an einen recht breiten Bach gelangten, der sich todesverachtend in die Tiefe stürzte. „Wo ist nun das Tor?“ Die Prinzessin musste ihre Stimme erheben, um den Sturm zu übertönen. Es gefiel ihr ganz und gar nicht, als der Druidh in die Schlucht hinab deutete. Der Wasserfall bildete mit einem Felsvorsprung, auf den er prallte, um sich dann in die endlos scheinenden Tiefen zu ergießen, ein Tor.
Der Prinzessin schien das Unterfangen, ausgerechnet dieses Cairn bereisen zu wollen, als zu gefährlich und aussichtslos. Man musste mehrere Meter über rutschigen Fels in die Tiefe steigen, nur um auf einem schmalen Steinband balancierend zwischen herabstürzenden Wassermassen und glitschiger Wand durch das Tor zu gelangen. Außerdem hatten sie nicht ausreichend Seil dabei.
„Magie“, grübelte die Prinzessin, doch der Druidh wehrte ab.
„Das ist das einzige sichere Cairn im Umkreis mehrerer Tagesreisen. Wir dürfen niemanden auf der anderen Seite auf uns aufmerksam machen.“
In diesem Moment stieß die Anagok den Schrei eines Raben aus. Es klang sehr sehr wütend und gleichzeitig, wie eine Herausforderung. Dann stieß sie ihren langen Stab, der mit schwarzen Federn und buntem Allerlei geschmückt war, in den Boden. Mit geschickten Fingern öffnete sie einige Beutelchen an ihrem Gürtel und begann damit ihr Gesicht mit roter Farbe zu bemalen. Ehe es sich Prinzessin Syria versah, trug auch sie dieselbe Bemalung wie die Anagok.
Die Schamanin holte aus dem Rucksack, den sie getragen hatte, die geschnitzte Rabenmaske hervor und hob sie dem Sturm entgegen.
Wieder fühlte die Prinzessin, wie damals, als sie zum ersten mal dieses Heiligtum der Apulaq-Taq ansichtig wurde, ein leises Verlangen danach es zu besitzen.
Der Sturm versuchte der Anagok die Rabenmaske aus der Hand zu reißen, so als stelle er ebenfalls gierige Besitzansprüche, doch musste er sich dem Willen der Schamanin beugen.
Plötzlich war es Windstill. Es war fast wie ein Schock. Aus dem lauten Schreien des Elementes Luft war betäubendes Schweigen geworden und nur das leise Flüstern, des sich in die Tiefe stürzenden Baches war zu hören.
Anagoks Mund umspielte ein leises Lächeln, als sie sich zur Prinzessin herumdrehte und ihr die Rabenmaske in die Hand drückte. Es ging alles sehr schnell.
Flugs war die Schamanin auf den Rücken des Kelpie gesprungen und zwang das Andersweltwesen auf den Bach zu. Es gehorchte wiederwillig schnaubend. Plötzlich brandete die Welle wildschäumend wieder empor, verschluckte Ross und Reiterin, um sie hinab in die Schlucht zu tragen. Doch das Kelpie war ein Wassergeist und so sprang es im rechten Augenblick durch das Tor hindurch.
Der Prinzessin war es in diesem Moment, als würde sich ihr ein großes Gewicht auf die Brust setzen. Sie blickte auf diese Stelle hernieder und sah, dass aus der Maske wohl ein Rabe geworden war, der sich nun auf ihrem Gewand ein Nistplatz gesucht hatte. Ob des Gewichtes, dass immer mehr zunahm, musste sich die Prinzessin niederlegen. Eine Schwinge, so schwarz wie die Nacht brachte ihr Träume.
Wildbunt umfloss sie wie singendes Wasser ein Regenbogen. Er führte sie mit sicherem Geleit in die Anderswelt hinein. Sie hätte schwören können körperlos zu sein und doch fühlte sie das fahlweiße Ross, das sie gegen seinen Willen zu tragen hatte, unter sich durch die Welten jagen.
„Mein Blut ist dein Blut“, hörte sie sich sagen und fühlte, wie sich ein Messer aus Bein in ihre Handfläche grub. „Und dein Blut ist sein Blut“, ein weiterer Schnitt wurde hinzugefügt, so dass ein blutiges Kreuz entstand.
Warm floss der Lebenssaft ihren Unterarm herunter und vereinigte sich mit den Farben des Regenbogens. Plötzlich ein Ruck und sie waren angelangt.
Wild peitschten die Wolken schweigend über den Himmel, der sich ihnen zu Füßen ergoss. Bäume wuchsen wie Vögel kreischend schuppenglitzernd durch die Ebene ziehend, wie große Herden einzelgängerischer Spreggans.
Dunkelheit ergriff drohend grell von ihres Verstandes Herz Besitz, drückte schmollend mit weitausgreifenden umfangenden Armen zu, als würde eine verhasste Tochter Heim kehren. Blutrotes Kreuz, engstirniger Glauben, Tod im Schatten hinter sich herziehend, beschienen von den Vieren, sich abwendend, duldend im Weg voraus.
Lachender Verrat umspielte sie wie ein uralter Greis und biss sich wie die Schlange allesverschlingend in den eigenen Schwanz.
Der Strudel des Allverstandes zog sie in den durchtriebenen Wahnsinn, hell weiß leuchtend und inmitten der Schwärze ein Kreuz, blutrot.
Immer wieder das Kreuz, blutend, sich in einen Strom vereinigend floss das Erbe voran, weg, weit fort. Weißblendende Hufe trugen ein weißblendendes Ross, denn hier war alles nicht so, wie es draußen erschien.
Hier sind die Gedanken die Geburt der Welt.
Auf einem weißen Ross folgte die schwarze Frau mit den Rabenschwingen dem blutroten Strom. Sie hatte in der Quelle dessen einen Drachen erspäht, der hinter ihr dunkel und gewaltig, wie ein Gebirge, den Horizont begrenzte. Sein Atem war der Wind, der ihr Leben einhauchte und seine Augen folgten ihr, wie das Wohlwollen eines Vaters, der auf sein allerliebstes Kind acht gibt.
Sie folgten seinem Blut, dass das Flussbett ausfüllte. An seinem Saum wuchsen Lilien aller Farben und eine Nachtigall erhob trällernd ihre Stimme. Ein Löwe mit goldener Mähne ruhte im hohen weichen Gras. Sein Schnurren war gewaltig und erfüllte beruhigend die Luft. Es war so schmerzhaft schön hier, dass man dazu genötigt wurde, zu verweilen. In weiter Ferne graste ein schwarzes edles Ross. Man hatte ihm den Sattel abgenommen, denn der diente einer Gestalt als Kopfunterlage. Der junge Mann ruhte sich im wärmenden Sonnenschein aus. Die Idylle um ihn herum, ließ ihn alsbald dämmrig einschlafen.
Die Reiterin hielt an und kniff die Augen zusammen. Sie vermeinte aus der Stirn und aus dem Herzen zwei silberne durchscheinende Fäden wahrzunehmen, die sich über der Brust zu einem vereinigten. Der Seelenstrang verlor sich in der Helligkeit der Luft über ihm.
„Bruder“, sagte die Frau und trieb ihr Pferd neben den Schlafenden. Dieser erwachte: „Schwester?“ fragte er verwirrt und blinzelte in das Sonnenlicht empor. „Es ist Zeit Heim zu kehren“, sagte die Frau.
„Nein, es ist Zeit für die Jagd“, erwiderte er und setzte sich auf. Mit schnellen gewohnten Handgriffen sattelte er sein Pferd und saß auf. „Komm mit mir, wir jagen heute Verräter“, forderte er sie lächelnd auf und reichte ihr die Hand. „Dein Körper stirbt“, sagte die Frau mit den Rabenschwingen. „Das ist mir einerlei.“ Der junge Mann trieb seinem Pferd die Hacken in die Flanken und raste davon. Am Horizont war eine dunkle Sturmfront aufgetaucht. Sie spie eine Vielzahl an Reitern und Streitwagen aus. Dumpfes Donnergrollen brandete durch die Idylle und ließ die Nachtigall inne halten. Der Boden erbebte und plötzlich war ein Wagen heran. Eine Frau, gekleidet wie eine Druidh stand mit hocherhobenen Haupt darauf. Locker hielt sie die Zügel der Vier eingespannten Pferde in der Hand: „So, du willst also haben, was mein ist? Und wenn ich es dir nicht geben will?“
Der Rabe spannte seine Flügel und seine Schwungfedern reichten von Horizont zu Horizont. Er war seine Nacht, er war sein Sturm, er war die Brücke nach Hause.
Die Druidh auf ihrem Streitwagen zeigte sich beeindruckt, vielleicht sogar ein wenig verunsichert. Doch eine Luchni trug nie eine Schwäche offen zur Schau.
Es kam zum Kampf. Die Druidh war die Sonne, die Schönheit und die Ruhe in des Prinzen Leben. Sie war die süße Verlockung des Todes und hoffte jeden Augenblick, dass seine sterbliche Hülle nun endlich vergehen würde. Die Schamanin war die Nacht mit ihren schwarzen Schwingen und brach wie eine Woge aus dem Stoff der Welt über der Luchni zusammen. Wie Vögel hoben sich Tag und Nacht empor, um einen Kampf auszufechten, der das Schicksal eines Sterblichen besiegeln würde.
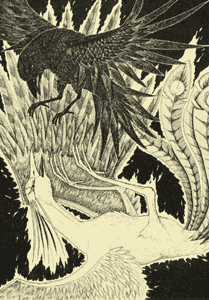
Leben oder Tod.
Die Sonne neigte sich dem Horizont entgegen und entsandte ihre ersterbenden Strahlen durch den einsetzenden Nieselregen. Ein prachtvoller Regenbogen entstand am blutroten Himmel, doch war er zum Vergehen verdammt. Bald schon würde die Macht der Natur über das Schicksal der Sterblichen obsiegen, denn das Rad der Zeit drehte sich unablässig voran. Denn mit der Nacht, das las er aus den Zeichen, würde die Passage durch diesen Cairn zu gefährlich werden.
Er verfolgte den Silberfaden der Prinzessin, der Seele und Körper miteinander verband mit seinem Blick in den Abgrund hinein. Schon begann der Regenbogen zu verblassen, als der Druidh hinter sich einen verzweifelten Atemzug hörte. Er drehte sich herum und erspähte im Strom des breiten Baches eine Gestalt, die sich mit verzweifelten Schwimmbewegungen an das Ufer zu retten trachtete.
Der Druidh trat in das Wasser hinein ergriff die Hände der Frau. Er zog sie zu sich auf festen Boden, als der Regenbogen endgültig verblasste und die Vorboten der Nacht das Land langsam in ihre Schatten hüllten.
Die Anagok ließ sich ermattet neben der Prinzessin nieder und nahm ihr die Rabenmaske aus den verkrampften Händen. Flatternd öffnete Syria die Augen und setzte sich auf. Ein gewisses Schwindelgefühl ergriff von ihr Besitz. Da war ein Schmerz in ihrer linken Handfläche und als sie sie sich ansah, erkannte sie das rote Kreuz darin. Lächelnd zeigte ihr die Anagok das Gegenstück in ihrem eigenen Fleisch. Sie waren in dieser Reise tatsächlich verbunden gewesen.
Blut lief der Prinzessin aus der Wunde und als sie dem Rinnsal mit den Blicken folgte, entdeckte sie, dass es um einen kleinen Stein am Boden eine Lache gebildet hatte. Mit kraftlosen Fingern kratzte sie das Stück aus der Erde und musste ihren Irrtum feststellen. Sie hielt mitnichten einen Stein in ihren Händen, sondern den Siegelring ihres Bruders, der den Drachenhainer Drachen zeigte.
Wie der hier her gelangt war … das blieb ein Rätsel.
Das Erwachen
„Nun ist er ist da, gerade noch rechtzeitig um vom Prinzen Abschied zunehmen! Der Prinz und damit die direkte Linie Drachenhain, wird wohl heute noch den letzten Atemzug auf dieser Welt tun!“ dachte sich Abt Remedius von Richilesruh und ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er, der Amtsnachfolger des jetzigen Bischofs auf dem Drachentrutzer Klosterstift, neigte vor dem Älteren ergeben das Haupt. An der trauervollen Miene des Bischofs erkannte er, dass dieser die Lage in all ihrer Gräuel auf einen Blick erfasst hatte. Allein schon dieser flinke Auffassungsgabe ließ den Abt zu seinem einstigen Mentor und Lehrmeister aufblicken. Remedius hatte ihm tatsächlich viel, wenn nicht alles, zu verdanken. Allein Ceridian Aegidio war es gewesen, der ihm, dem damals noch land- und hoffnungslosen Edlen Hrabas von Baldwiesen, von den verruchten Schenken und Straße holte und ihm in der ceridischen Kirche eine neue Heimat verschaffte. Der Alte errettete ihn und setzte ihn später, nachdem er sich bewährt hatte, neben sich in Amt und Würden. Remedius selbst dankte dem Bischof dieses Vertrauen allewege durch Fleiß und Tugend. Für ihn war der greise Mann stets Vater und Vorbild gewesen, er kannte keinen Menschen, der mildtätiger und sanfter ist.
Der Bischof erwiderte wohlwollend den Gruß, trat zu ihm an das Krankenlager des Sterbenden, besah sich mit kummervollem Blick den wie unbeweglich Daliegenden und reichte dem Abt sogleich das mitgenommene Weihrauchfass. „Er erscheint mir so viel jünger“, dachte sich Remedius im Stillen, „die Arbeiten und Aufgaben eines Bischof scheinen ihm offensichtlich gut zu tun – wie elend und alt im Vergleich zu ihm Prinz Leomar aussieht!“ Nachdem er im stillen Gebet das Rauchwerk entzündet war, füllte der edle Duft sofort jeden Winkel des Raumes aus, der Abt liebte diesen Geruch. Von fern vernahm er die ausklingenden Glocken der Feste, dann folgte Stille.
Für Prinz Leomar würde es wohl im Grunde ein schneller und damit sanfter Tod sein. Erst gestern hatte sich plötzlich das hohe Fieber entwickelt und war binnen Kurzem auf ein solches Maß angestiegen, dass den erfahrenen Heilern und Medici rasch klar wurde, dass es mit dem Prinzen recht bald zu Ende gehen wird. Entgegen allen Ratschlägen seiner Vertrauten beschloss der Fürst keinerlei weiteren Personen von dieser tragischen Nachricht in Kenntnis zu setzen. Zu Remedius Entsetzen war weder Schwester, noch Freunde oder sonstige Anverwandte benachrichtigt worden. So war es um den Abt eine kleine Runde, die den Thronfolger des Fürstentums bei seinem letzten Gang begleitete. Mit Prinz Leomar wird nun das stolze und alte Haus Drachenhain verglimmen. „Oh Einer, welche Zukunft erwartet Dein Drachenhain?“
„Cum venit tempus, quod tu floruisti in ramis tuis…“ erst leise summend, dann immer lauter werdend, stimmte der Bischof den alten ceridischen Choral an, in den erst Remedius, dann Fürst und hernach alle anderen mit einfielen. Am Ende hallte der große Raum vom Schall der frommen Worte wieder, allen Beteiligten liefen Tränen der Trauer von den Wangen.
Unendlich langsam sah der Abt wie sich des Bischofs alte Hand dem Antlitz des Prinzen näherte. Sanft lächelnd legte Ceridian Aegidio dem Prinzen zum endgültigen Abschiede die Hand auf die Stirn, wie er es wohl auch vor Jahrzehnte zu dessen Taufe getan hatte. Und da geschah plötzlich das Unfassbare. Erst dachte er der Weihrauch trübe ihm die Sinne, aber nein, mit einem Mal sah Remedius wie der todgeweihte Prinz erstmals seit Monden die Augen aufschlug und blinzelte, in tiefen Zügen einatmete, sich mit einem Male aufbäumte und letztlich vollkommen entrückt in die erschrockenen Gesichter der Menschen um ihn schaute. Dann verließen ihn die Kräfte jedoch wieder und er sank in einen ruhigen und friedlichen Schlaf. Ringsum waren nun alle hellauf begeistert und lagen sich weinend in den Armen: „Ein Wunder, ein Wunder ist geschehen!“ rief Remedius glückseligst aus und die Menschen fielen demutsvoll einer nach dem anderen zum Dankgebete auf die Knie. Abt Remedius war nun außer sich vor Freude: „Seht, der Eine hat durch die Hand des Bischofs ein Wunder getan und uns den Toten wiedergegeben! Lob und Preis Dir, oh Einer, für Dein göttliches Geschenk!“
Die Kettenhunde
Das erste, das Prinz Leomar gewahrte als er aus seiner tiefen Besinnungslosigkeit wieder zu sich kam, war der Stillstand des Wagens. „Haben wir unser Ziel etwa schon erreicht?“ Schoss es dem Prinzen durch den Kopf. Doch dann vernahm er von draußen einige Stimmen, vor der Kutsche diskutierten welche miteinander. Noch bevor er auch nur ein Wort der Unterhaltung verstanden hatte, war ihm klar: „Sie haben uns!“
Leomar lauschte nun den Männer und fand seine Vermutungen bestätigt. Eine tiefe Stimme rief gerade barsch: „Los Bronu, im Namen seiner Durchlaucht Fürst Waldemar von Drachenhain. Steig ab vom Kutschbock! Oder sollen wir dir tatsächlich Gewalt antun?“ Ein anderer sagte in etwas versöhnlicherem Ton: „He alter Freund. Lass doch den Unfug und steck das hässliche Ding weg. Du könntest noch jemanden verletzen!“ Dann vernahm Leomar zu seiner Erleichterung die zwar etwas zittrige, aber nichtsdestoweniger tapfere, Stimme seines Dieners: „Nn..nein! Der Herr hat mir befohlen ihn ins Tlamanische zu fahren und ich gehorche, jawohl!“ „Aber schau doch“ versuchte ihn der Sanfte mit einschmeichelndem Ton zu überreden „Fürst Waldemar wünscht es doch so. Willst du gegen den direkten Befehl seiner Durchlaucht handeln? Wem fühlst Du Dich denn verpflichtet, dem Fürsten oder einem…“ Leomar hatte genug gehört. Er sammelte seine letzten Kräfte, öffnete mit einem Ruck die Tür und sprang aus der Kutsche, es war helllichter Tag. „Einem WAS?…. Sprecht getrost weiter, Radulf von Ettelberg und Betzo Odalwehr!“ erschrocken wichen die beiden Gestalten, der eine groß und bullig, der andere schmal und drahtig, zwei Schritte zurück „Da hat der Fürst ja seine besten Kettenhunde auf uns losgelassen, braver Bronu. Aber sei unbesorgt, zubeißen getrauen sie sich doch nicht!“
„Euer Hochgeboren, ihr seid … gesund?“ fragte der raue Betzo mit einem Mal höchst unterwürfig „Nicht nur gesund, sondern auch bei vollen Sinnen! Macht also, dass ihr Heim zur Feste kommt und richtet dem Fürsten aus, dass der Eine sich in mir wohl getäuscht haben müsse. Bestellt ihm dies!“ Radulf hob indes an zu sprechen „Aber, aber Euer Hochgeboren, seid doch vernünftig! Geht mit uns und sprecht noch einmal mit Eurem Vater, so dass ihr im Frieden voneinander scheidet!“ während er beschwichtigend redete, setzte sich Betzo auf dessen Zeichen hin behutsam in Bewegung. Offensichtlich versuchten die Beiden ihn mit Gewalt zur Feste zurückzubringen. Was nur soll ich tun? Noch bin ich zu schwach zum Kämpfen, dachte sich Leomar, Betzo kam schon bedrohlich nahe, da war plötzlich ein Klicken und gleich darauf, des Dicken Schmerzgeheul zu vernehmen. Aus seinem Schenkel ragte die Befiederung eines tief im Fleisch steckenden Bolzens. „Das sollst Du mir büßen, Bronu! Komm Du nur heim zur Feste, dann kannst du etwas erleben!“ bellte Betzo ächzend. Radulf besann sich kurz, wahrscheinlich überlegte er, ob er lieber Leomar fangen oder doch besser seinem Kameraden zur Hilfe eilen sollte, da sah er Leomars blanke Klinge seinem rechten Auge entgegengestreckt. Radulf hob ergeben die Hände: „Gut. Ihr wolltet es nicht anders, Prinz. Betzo und ich haben getan was in unserer Macht stand!“ Dann wandte er sich zu seinem Kameraden und half diesem auf dessen unweit angeleintes Pferd, schwang sich dann auf sein eigens Ross und so ritten beide grußlos, aber vor sich hinfluchend, davon.
Als die Reiter außer Sicht waren, sackte Leomar in sich zusammen. Der Streit hatte ihn zuviel seiner Kraft gekostet. Hätten Betzo und Radulf sich in diesem Augenblick besonnen und umgekehrt, sie hätten wahrlich leichtes Spiel gehabt. Stattdessen aber stieg der brave Bronu nun doch noch von seinem Kutschbock und hob seinen jungen Herrn ins Innere des Wagens zurück. Mit den Worten: „Auf nach Tlamana, auf zu Leabell, tapferer Bronu! Bald sind wir da!“ sank Prinz Leomar wieder in die schwarze Tiefe der Ohnmacht.