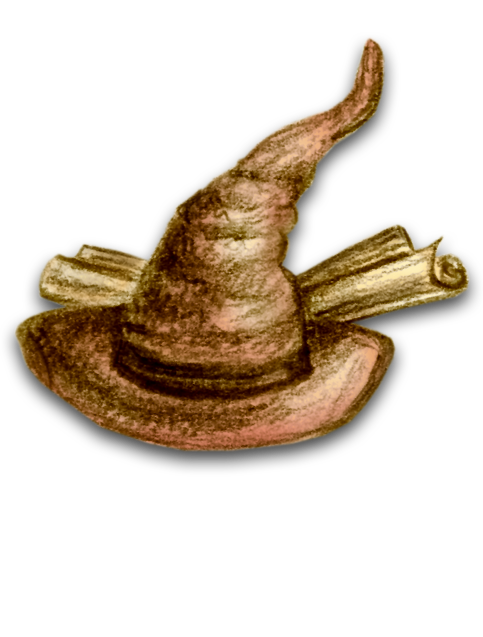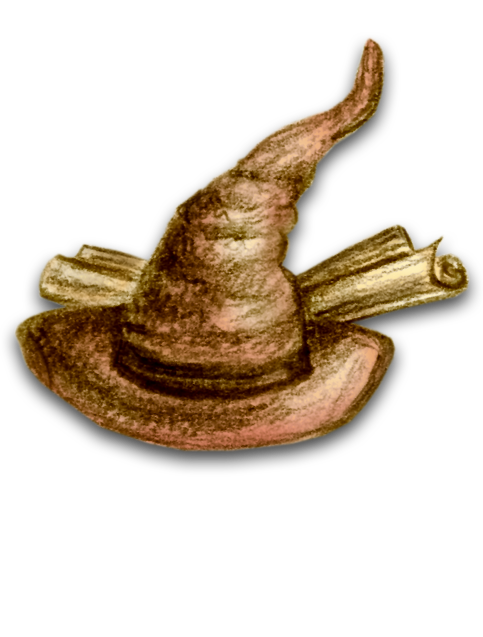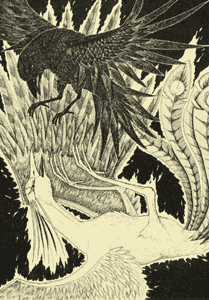Die Nacht war kalt und regnerisch. Nicht das angenehmste Wetter um zu reisen, aber dieser Ritt schien endlos lang zu werden. Elf Gestalten preschten durch die Nacht, so schnell es eben ging, darunter Ritter der Thaler Ritterschaft, Magistra Tiziana von der Akademie der schönen Künste in Betis mit ihrem Begleiter Felice, Baron Hektor von Eichenstein, seine Hochgeboren Prinz Anselm von Thal, sowie Magister Londaé von Sargentis und Magister Hannes Reichenbach von der Academia Rei Praeheliotica. Vorne weg, meist einige Meilen voran, eilte ein Späher, um vor allen Gefahren und Unbillen zu warnen – und er sollte noch einiges zu tun bekommen. Der Grund ihrer Reise waren die Kunstwerke mit wohl schwerwiegender Bedeutung. Diese sollten unter allen Umständen dem König überbracht werden. Und jeder, der auf dem Convent in Idyllie zugegen war ahnte, wie groß die Gefahr dieser Reise sein konnte.
Die vom Schloss kommenden hatten nur kurze Zeit im Dorf verbracht, um sich auszurüsten und die Ritter und den Späher mitzunehmen. Kaum eine Viertelstunde hatte dies gedauert und nun saßen alle auf den besten Rössern aus dem Gefolge des Prinzen.
Die erfahrenen Reiter aus der Ritterschaft und dem Adel konnte die Kälte und die Anstrengung des Rittes nichts anhaben, die Magister aus Idyllie hatten schon eher ihre Mühen, doch die Betiser waren an ihren Grenzen. Ständig glaubten sie in den Geräuschen des Waldes Stimmen und Schritte zu hören, ständig ermahnten sie die anderen ob der Gefahr im Dunkel. All das trug nicht gerade dazu bei, die Stimmung zu heben, als plötzlich eine Gestalt am Wegrand aus dem Dunkel auftauchte.
Der Mann schien dort gestanden und gewartet zu haben.
Eine Vorhut ritt zu ihm und die armselig wirkende Gestalt war im Schein der Laterne zu erkennen. Abgetragene Kleidung, Schmutz überall und der Blick so wirr wie sein Haar.
„Hallo, da seid ihr ja!“ begrüßte er sie mit irrem Klang in der Stimme. „Wer seid ihr?“ erging die Frage an ihm, um als Antwort den Namen Aedh zu bekommen.
Aus unerfindlichem Grunde schien Aedh genau zu wissen, wo die Kunstwerke aufbewahrt wurden, denn er starrte wie von Sinnen in diese Richtung. Er sprach davon, dass man sie in die Jolsee werfen und vergessen sollte, das sei seiner Meinung nach das Beste. Ständig redete er davon, dass etwas zu spüren sei und bohrte mit der Frage „Spürt ihr es nicht?“ mehr als einmal nach. Doch die Reiter spürten nichts. Plötzlich jedoch fiel Aedh wie vom Schlag getroffen um und blieb leblos liegen. Die Reisenden gaben ihren Pferden die Sporen. Es war keine Zeit, um zu diskutieren, denn die Zeit spielte gegen sie und sie wussten nun, dass man sie erwarten würde.
Irgendwann in der Tiefe der Nacht stürzte einer den Ritter. Kein Hindernis war zu sehen, kein Stein und der Ritter war ein guter Reiter. Wohl nur ein Versehen.
Dann stand ein Bauer am Wegesrand. Mitten in der Nacht, mit einem Bündel Holz und wartete. Der Späher hatte ihn nicht gemeldet und als die Gruppe vorbei preschte tat er nichts und sagte nichts. Und doch war sich Felice sicher, die Worte „Das war’s!“ gehört zu haben – aber gerade Felice glaubte vieles zu hören im Wald. Und doch wurde die Beklemmung immer größer. Mal glaubte jemand, eine Person säße mit auf dem Pferd, mal war der Atem eines Wesens im Nacken zu fühlen. Die Nacht zog sich hin.
Der Ritter stürzte wieder. Wieder ohne Grund, doch diesmal war das Pferd so schwer verletzt, dass des nicht mehr zu reiten war.
Prinz Anselm von Thal und ein weiterer Ritter blieben zurück und wiesen die Gruppe an, ihren Ritt fortzusetzen. Als geübter Reiter und Pferdekenner untersuchte der Prinz das Tier. Sein Bein schien nicht gebrochen, doch schwer gestaucht. An die Fortsetzung des Rittes war nicht zu denken. Der Sattel wurde abgenommen und auf dem Pferd des Prinzen festgemacht, während sich die beiden Ritter ein Ross teilten. Es galt wohl im nächsten Dorf Ersatz zu suchen. Da war auf einmal eine Gestalt im Dunkel zu erkennen, gerade so als Umriss, doch zu weit im Dunkel, als dass das Gesicht zu erkennen wäre. Zu Anselm, der noch immer das verletzte Tier begutachtete tönte eine Stimme „Töte es lieber gleich!“ Anselm aber weigerte sich aber und brachte ein, dass der Tod des Pferdes nicht von Nöten sei. Er ging auf die Gestalt zu, um das Gesicht zu erkennen, doch sie wich zurück. „Feigling! Hast du Mitleid?“ „Ich habe dem Pferd das Leben nicht geschenkt, ich werde es ihm auch nicht nehmen.“ Nach diesen Worten ritt die kleine Gruppe los, um die anderen einzuholen.
Kaum waren alle wieder beisammen, tauchte die Gestalt wieder auf, nur eine Silhouette in der Finsternis, die neben Londaé ritt. „Warum reitet ihr so schnell?“ Auf die Frage des Magisters nach Name und Begehr kam nur die Antwort „Ich reite schon mal vor“. Schnell wie ein Pfeil zog der Schatten an den Reitern vorbei und war verschwunden.
Endlich hörte der Regen auf.
Der Morgen graute, als ein Dorf in Sicht kam, umgeben von einer Palisade, um die Tiere des Waldes fern zu halten. Ein kleiner Weiler, vielleicht 5 Höfe. Seltsamerweise war vom Späher nichts zu sehen und nichts zu hören.
Der größere Teil der Gruppe wollte langsam weiter reiten, nur Baron Hektor und ein Ritter sollten ein Ersatzpferd finden. Die Betiser freuten sich über den langsameren Ritt, denn die Nacht hatte sie sehr erschöpft und auch Hannes war nicht abgeneigt, da ihn Kopfschmerz quälte.
Als der Baron ans Tor klopfte, schwang dieses auf. Es bot sich ein seltsames Bild. Vor einem einzelnen Gebäude, welches die Taverne zu sein schien, stand ein Pferd. Es war gesattelt und schien auf seinen Reiter zu warten, doch war es nicht angebunden. Auf dem Weg zur Taverne lagen 3 leblose Körper, wohl einige der Bewohner, mit dem Gesicht nach unten. Hektor witterte eine Falle und folgte der Gruppe. Dort wurde die Lage besprochen. Auch wenn die Gefahr groß war, so hatten die Reiter doch die Pflicht, den Bewohnern des Dorfes zu helfen, hatten doch die Adeligen einen Eid darauf geschworen, dies zu tun. Und so wurde gewendet.
Als das Dorf wieder in Sicht kam, mochte es wohl um die achte Stunde des Tages sein. Auch wenn es nun heller war, schien der Tag nicht richtig anbrechen zu wollen. Weder Sonne noch Mond standen am Himmel und das Licht war durch die Wolken dumpf und matt.
Magister Reichenbach zog es vor, vor dem Weiler zusammen mit den Betisern und einigen Rittern zu warten, da seine Kopfschmerzen weiter zunahmen.
Mehrere der Reiter betraten das Dorf. Die Luft war geschwängert von einem Brandgeruch und Londaé fand die Ursache, als er einer der Körper umdrehte. Verbrannt, völlig verbrannt war die Vorderseite. Haut war mit Stoff verklebt und an manchen Stellen traten Knochen im schwarz verkohlten Leib hervor. Der Magister trat zurück.
Gerade aber als Londaé den Toten drehte, glaubte Hannes, noch immer von Schmerzen gequält, helles Licht zu sehen, als würde die Sonne am Himmel stehen. Nur einen Moment, dann war es auch für ihn wieder Grau in Grau.
Währenddessen erkannte Prinz Anselm das noch immer freie Pferd. Es war ein Tier aus einem Thaler Stall. Das Pferd des Spähers.
Baron Hektor betrat die Taverne. Auch hier war Brandgeruch in der Luft und die hinter der Theke zu erkennende Gestalt auf dem Boden schien wohl die Quelle zu sein.
Da war die Stimme des Spähers zu vernehmen und kurz darauf auch sein Leib zu sehen. Wie eine Marionette hing der Gefährte in der Luft, die Augen leblos und doch sprach er, gelenkt und bewegt von einer schattenhaften Gestalt hinter ihm. Einige Wort wurden mit dem Späher, nein, mit seinem dämonischen Lenker gewechselt. Jener gab an, Helios Licht zu ertragen und führte noch so manche üble Rede. Das Wesen versuchte die Zuhörer zu verführen, ihm näher zu kommen, doch Hektor warf noch einen Dolch, nach dem Körper des Spähers, um sicher zu sein, das er tot sei und nicht zu leiden habe. Dann verschwanden die Reiter so schnell sie konnten. Diesem Wesen waren sie nicht gewachsen.
Die Gruppe ritt weiter. Hannes hatte in der Pause nicht die erhoffte Erholung gefunden, und sein Schmerz wurde stärker. Während des Rittes wurde eifrig beraten. Da wohl die Nähe der Kunstwerke ein Auslöser der Geschehnisse war, wurde beschlossen, sich für einen Tag zu trennen, um zu sehen, was geschähe. Während dieser Beratung war wieder die Stimme zu hören, diesmal von Tiziana und wieder sah Hannes dieses Aufblitzen.
An der nächsten Wegkreuzung trennte sich die Gruppe. Prinz Anselm, Hannes Reichenbach und 2 Ritter nahmen einen etwas längeren Weg, während der Rest der Gruppe weiter auf dem Hauptstraße bleiben sollte. Gemäß der Karte sollte es sich dabei um einen knappen Tagesritt handeln und man würde sich zur Abenddämmerung wieder treffen, wenn man bei dem trüben Licht überhaupt von einer Dämmerung sprechen konnte.
Also folgte die größere Gruppe der Hauptstraße. Aber kaum eine Wegstunde später hörten die Reiter Hufgetrampel und trafen auf einer Kreuzung, die es laut Karte gar nicht gab, die anderen. Verwirrt wurde nach dem Losungswort gefragt und die Antwort war richtig. Aus unerklärlichen Gründen hing Hannes Reichenbach bewußtlos im Sattel. Wie konnte dies alles geschehen? Der Magister wurde wieder aus seiner Ohnmacht geweckt. Hannes Kiste wurde an Prinz Anselm übergeben, um zu ergründen, ob dies die Ursache für seine Qualen war. Die Magister kamen zu dem Schluss, dass all das eine Illusion, eine Lüge sei. Da meldete sich die Stimme wieder. Doch diesmal antworteten die Reisenden nicht mit Worten zu der Stimme, sondern mit Worten zu den Vieren. Gebete wurden gesprochen, was der Stimme sehr missfiel. Als dann auch noch die Gelehrten ihren Teil taten, geschah, womit keiner rechnete.
Die Umgebung war anders, alles war anders und jemand fragte verwirrt „Was sagt ihr da?“ Es waren die ungläubigen Worte des Spähers, der vor den Reitern auf dem Weg stand. Die Gruppe befand sich eine halbe Stunde Ritt vor einem Dorf.
Auf dem Weg dorthin hatten die beiden Gruppen endlich Zeit, das Geschehene ausführlich zu berichten. Während die Reiter um Baron Hektor nur einmal die Stimme vernahmen, war die Geschichte von Prinz Anselm länger. Er erzählte von einem Dorf, dessen Bewohner sie empfangen hätten. Wieder war die Stimme aufgetaucht und hatte offenbar sowohl einen einfachen Bewohner als auch einen Poenageweihten getötet. Während all dieser Zeit wurden Hannes Schmerzen immer größer und plötzlich erkannte dieser statt des Dorfes eine einfache Wiese in Helios Licht und keine Menschenseele. Als er das prüfen wollte, verlor er das Bewusstsein. Ein schneller Ritt brachte dann auch diese Gruppe auf die Kreuzung, wo sich alle begegneten.
Der Späher hatte nur den Eindruck gehabt, als wären die Reiter etwas geistesabwesend, doch bemerkt hatte er nichts.
Während all dieser Erzählungen kam das Dorf in Sicht. Es war genau das Dorf, in dem sie die Toten zu finden geglaubt hatten. Das Dorf, in dem das Pferd des Spähers gesehen wurde. Als alles überprüft wurde, stellte sich heraus, dass das letzte, das wirklich geschehen war, die Verletzung des Pferdes auf der Straße im Wald gewesen war.
Da die Gebete anscheinend geholfen hatten, die Illusion der Stimme zu vertreiben, wurde im Ort der Poenaschrein aufgesucht, um dort um den Beistand der Viere zu beten. Es wurde auch der Beschluss gefasst, nachts zu rasten, um den Gefahren der Nacht zu entgehen und jeden Tag einen Schrein aufzusuchen.
Im Dorf wurde das Pferd gekauft, das die Ansprüche als Reittier am ehesten zu erfüllen schien, wurde gekauft. Seltsamerweise war die Illusion, die Lüge so ermüdend gewesen, als wäre sie Realität. Doch nach einem kräftigen Mahl und einigen Stunden Schlaf, ritt die Gruppe weiter, um noch die nächste Poststation zu erreichen, bevor die Nacht herein brach. Ab dann würde die Reise auf der Reichsstraße A1 verlaufen.
Am Himmel waren immer noch Wolken, doch spitzelte immer wieder die Sonne durch und gab Hoffnung. So verging der Weg zum Nachtquartier wie im Fluge. Nach einem Gebet im Xurlschrein, war auch die Nacht so still wie jede andere und trotz des Wachwechsels hatte keiner Mühe, Schlaf zu finden.
Der Ritt des nächsten Tages begann im Morgengrauen und es sollte ein sonniger Herbsttag werden. Nun, da sich die Reiter auf der Reichsstraße A1 befanden war der Verkehr deutlich dichter als bisher. Regelmäßig begegneten sie Reitern oder Gespannen auf der Straße, aber kaum jemand hatte es so eilig wie sie. Die Ruhe des letzten Tages ließ die Zuversicht in allen wachsen. Nur der Späher schien besorgt und irgendwann meldete er auch, dass er glaubte Verfolger oder Gestalten im Wald gesehen zu haben. Da der Späher durchaus geübt in seiner Profession war, zeigte diese Nachricht auch ihre Wirkung und man ließ mehr Vorsicht walten.
Einige Zeit später hielt ein Kutscher, wohl ein fahrender Händler neben der Gruppe an. Mit flinken Worten pries er seine Waren und war bereit, auch allerlei als Bezahlung anzunehmen. Plötzlich ernst geworden teilte er mit, dass er auch die Kunstwerke im Tausch gegen seine Waren tauschen würde. Keiner stellte mehr Fragen und ohne viel Federlesens ritt die Gruppe aus Idyllie weiter.
Das Tempo war stramm, gerade so, dass es die Pferde nicht übermassig ermüden würde.
Das Gefühl, verfolgt zu werden wurde immer stärker und mit einem Male, ohne Vorzeichen stürzten 2 Bäume des umgebenden Waldes auf die Straße. Die Ritter zogen blank und so schnell es ging wurde das Hindernis überwunden oder umgangen.
Wieder verspürte Hannes Kopfschmerzen, was für weitere Unruhe sorgte, da diese wohl ein Zeichen für irgendwelche Manipulationen waren. Wieder war die Stimme zu hören und es war, als würde eine Kraft an den Kunstwerken zerren.
Dann war die Stimme verschwunden, nur Hannes Schmerzen blieben.
Der Ritt folgte der Straße und wieder blieb es einige Zeit ruhig. Ein Bauer kam mit einem Korb voll Waren entgegen und grüßte freundlich. Dann jedoch, als die Reiter schon vorüber waren, grüßte er nochmals. Allein, hinter der Gruppe ritt und ging niemand – aber warum sollte der Bauer sonst grüßen? Verwunderung stellte sich ein. Wieder wurde das Tempo für eine Weile erhöht.
Der Weg zog sich hin, aber es war erstaunlich ruhig. Geradezu verdächtig wenig Verkehr auf einer der wichtigsten Straßen Heligonias, denn die Reiter waren schon einige Meilen niemandem mehr begegnet.
Am nächsten vereinbarten Treffpunkt mit dem Späher war keine Menschenseele.
Die Gelehrten machten sich auf zu untersuchen, ob es sich wieder um eine Täuschung handeln würde. Und Hannes bestätigte dass die Straße echt sei, wenn auch mit einer Stimme, die abwesend klang. Gerade als Prinz Anselm ein Geräusch im Unterholz zu hören glaubte, war von Hannes noch ein „Da ist noch wer“ zu hören, vor er unter Schmerzen zusammensackte.
Magister Londaé versuchte noch, gegen das anzukämpfen, was da war, doch es schien nicht zu gelingen. Dann ging alles ganz schnell.
Eine Stimme rief: „Keinen Schritt weiter!“ Rings um die Reisenden tauchten Männer im Gehölz auf. Sie hielten Armbürste in der Hand und sahen auch so aus, als könnten sie damit umgehen. Aus Richtung Norden kam ein Ritter hoch zu Ross, das Visier des Helmes geschlossen und ebenfalls mit einer Armbrust bewaffnet.
Als sein Pferd stand, sprach er Prinz Anselm an, er solle die Kunstwerke übergeben und es würde niemandem etwas geschehen. Sie dürften Escandra nicht erreichen, sondern müssten ihren Weg gehen. Die Frage nach Namen und Herkunft des unbekannten Ritters fand keine Antwort. Baron Hektor forderte ihn zum ritterlichen Zweikampf, um die Sache zu klären. Doch der Ritter schlug das mit Bedauern aus, da er an höhere Eide gebunden sei. Er teilte den Gefährten auch mit, dass er zwar für das Königreich sei, aber nicht auf königlichen Befehl handeln würde. Immer wieder jedoch wies der Fremde darauf hin, dass er niemanden verletzen wollte, schon gar nicht Personen von so hohem Stand.
Während des kurzen Gesprächs kam Hannes wieder zu sich.
Als hätte ihn jemand darauf hingewiesen, blickte er den Weg zurück, den sie gekommen waren. Dann zog er seinen Dolch, machte einige Gesten und da sahen alle, was er sah. Aedh.
In der dadurch entstandenen Verwirrung zog Prinz Anselm mit einer fließenden Bewegung seinen Bogen und richtete die Waffe auf einen der Armbrustschützen. Beschwichtigend redete er auf den Angreifer ein, er solle sich zurückziehen und es würde ihm nichts geschehen. Allein, es tat sich nichts. Nach einer Weile befahl der fremde Ritter seinen Mannen, die Waffen zu senken und auch der Prinz senkte den Bogen.
Die Gelehrten währenddessen hatten andere Sorgen. Aedh begann nun seinerseits, mit den Armen zu gestikulieren und murmelte Worte vor sich hin. Die beiden Tlamaner versuchten ihn daran zu hindern, den Zauber zu vollenden. Doch es gelang ihnen nicht.
Gerade als alle ihre Waffen zu Boden richteten, begann Aedhs Magie zu wirken. Eine unnatürliche Schwere und Schläfrigkeit legte sich auf die Gefährten. Magistra Tiziana konnte sich gerade so wach halten und Prinz Anselm schien vom Zauber völlig unbeeindruckt. Doch die anderen sanken in einen traumlosen Schlaf.
Der Ritter sprach mit Verwunderung: „Prinz Anselm, das hätte ich nicht von Euch erwartet. Ich zähle bis zehn, dann steigt auch Ihr bitte von Eurem Pferd ab. Sonst sehe ich mich gezwungen, Euch zu verletzen.“
Langsam und mit fester Stimme zählte er bis zehn. Prinz Anselm wich keinen Finger breit.
Dann hörte man das Surren der Sehnen und den dumpfen Aufschlag der Bolzen auf und durch die Rüstung des Prinzen. Leblos fiel Anselm vom Pferd.
Diesen Moment nutzte Tiziana. Sie zog ihr Gürtelmesser, ritt auf Aedh zu und verwundete ihn am Arm. Dann aber gab sie ihrem Pferd die Sporen um das Kunstwerk, das in ihrer Satteltasche war, zu retten. Trotz ihrer bescheidenen Reitkünste trieb sie ihr Pferd immer weiter an und sie klammerte sich mehr an den Hals des Tieres als sie im Sattel ritt. Erst einige Meilen weiter, als sie sicher war, niemand würde sie sehen, versteckte sich die Magistra im Unterholz und beobachtete die Straße.
Dort verharrte die Betiserin. Es war zu unwahrscheinlich, dass sie unverfolgt bliebe. Und tatsächlich kamen einige Minuten später der fremde Ritter und Aedh die Straße im gestreckten Galopp entlang geprescht. Den Vieren sei Dank, Tiziana blieb unbemerkt. Sicherheitshalber verließ sie auch weiterhin ihr Versteck nicht. Wohin sollte sich auch gehen? Eine Weile später kam Hannes Reichenbach mit zwei Rittern der Thaler Ritterschaft die Straße entlang, ebenfalls im schnellsten Ritt. Tiziana gab sich zu erkennen.
Hannes berichtete was geschehen war. Die Angreifer hatten Anselm schwer verwundet, ihn aber notdürftig verbunden. Anscheinend achteten sie das Leben der Überfallenen tatsächlich so hoch, wie sie sagten. Anselm sei versorgt und auf eine eilig gebaute Schleiftrage legt worden, um ihn zum nächsten Posthalterei zu bringen. Allerdings waren die Kunstwerke, die Hannes bei sich trug, verschwunden und wer sie genommen hatte, war wohl außer Frage. Irgendwann seien zwei Reisende aufgetaucht, die immer nur dumpf den Satz „Wir wollen nach Süden“ von sich gaben. Da Hannes diese als Diener des Unsichtbaren einschätzte, die entweder auf der Suche nach Aedh oder Tizianas Kunstwerk, ritt er in diese Richtung, um die Betiser Magistra zu finden.
Kaum hatte er das erzählt, kam Baron Hektor auf seinem Schlachtross angeprescht. Mit wutverzerrtem Gesicht fragte der Haudegen, nach dem Ritter und Aedh. Als er die geforderte Antwort erhalten hatte, galoppierte der weiter und keiner wagte zu fragen, was er vorhatte.
Wieder eine Weile später kam Londaé zusammen mit dem Späher des Weges. Londaé nahm sich etwas Zeit, um einige geschehene Dinge zu erklären. Hektor war der Spur der Angreifer gefolgt, die wohl einen kleinen Umweg genommen hatten. Nachdem der Prinz soweit versorgt war, folgte Londaé mit dem eben angekommenen Späher ebenfalls der Spur. Doch wie sollte es nun weiter gehen? Nach einigem Hin und Her kam man zu dem Schluss, dass die Aufgabe, das verbliebende Kunstwerk nach Escandra zu bringen, noch immer Vorrang hatte. So ritten Tiziana, Hannes und der Späher zusammen mit den Rittern wieder gegen Norden, um die verbliebenen Ritter und den Prinzen einzuholen. Allerdings wurde wieder ein Umweg gewählt. Keiner hatte Lust, die Begegnung mit den Dienern des Unsichtbaren zu wagen. Londaé selbst folgte Baron Hektor in südlicher Richtung.
Die Gruppe um den Prinzen war bald ausgemacht. Sie ritten Richtung Norden, kamen aber nur langsam voran. Anselm war noch immer ohne Bewusstsein und eine ordentliche Versorgung seiner Wunden war unbedingt von Nöten. Wieder wurde der Späher losgeschickt. Die nächste Posthalterei konnte kaum mehr eine halbe Wegstunde entfernt sein und der Thaler Recke sollte alles für die Ankunft vorbereiten.
Als die Begleiter Anselms in der Dämmerung im nächsten Dorf ankamen, wussten sie auch, dass der Späher seinen Auftrag erfüllt hatte.
Heißes Wasser und Verbandstuch lagen für Anselm bereit, für die anderen war ein kräftiges Essen bereitet und der Schlafsaal des Gasthofes stand ihnen offen. Doch konnte niemand viel für Anselm tun, denn ein einfacher Verband konnte hier nicht weiterhelfen und es war kein Heiler zugegen.
Eine gute Stunde später kamen auch Baron Hektor und Magister Londaé an. Irgendwann in der Dämmerung hatten sie die Spur verloren und waren zurückgekehrt, um den anderen zu helfen.
Londaé als erfahrener Heiler machte sich sofort daran, den Prinzen ausgiebig zu behandeln, was die halbe Nacht in Anspruch nehmen sollte. Keiner wollte berichten, was hinter der verschlossenen Tür geschah, aber am nächsten Morgen war Anselm soweit genesen, dass er aus eigener Kraft reiten konnte.
Hannes Reichenbach machte sich auf, in der Dorfschmiede die Rüstung des Prinzen zu flicken. Der Schmied hatte seine Freude daran, nach langen Jahren endlich wieder etwas anderes zu tun, als Hufeisen anzupassen und nie brannte das Feuer in seiner Esse heißer als in dieser Nacht.
Baron Hektor jedoch schnaubt noch immer vor Wut. Er bestellte ein Mahl für sich, eine Kanne starken Kaffee und setzte sich in die Gaststube. Nach dem er satt war, blieb er dort sitzen, rammte seinen Dolch immer wieder und wieder in die Tischplatte und wartete. Eine Duellforderung war noch offen und wenn der Fremde Ehre besaß, dann würde er kommen.
Dann, Stunden später, ging die Tür auf, der Torwächter kam herein und flüsterte dem Wirt etwas ins Ohr. Dieser deutete auf Hektor. Der Recke jedoch musste nicht erst hören, was der Wächter zu sagen hatte. Er sprang auf, nahm Helm, Schild und Schwert und ging mit entschlossenem Schritt auf den Dorfplatz.
Dort befand sich der Erwartete, hoch zu Ross, das Visier noch immer geschlossen. Erst jetzt fiel dem Baron auf, dass weder Rüstung noch Ross des Fremden Wappen, Markierungen oder Brandzeichen hatten. Sehr ungewöhnlich, denn es war eine Rüstung, die einem Ritter würdig war und gleiches galt für das Pferd.
Der unbekannte Kämpe stieg von seinem Reittier. Da er kein Schild hatte, warf auch der Baron das Seinige weg. Es war ein Kampf der Ehre.
Die beiden Recken umkreisten sich wie Raubtiere. Ihre Schwerthiebe waren hart und unerbittlich und das helle Klingen der Waffen war weit zu hören. Sie waren einander ebenbürtig. Jeder versuchte, den anderen zu überlisten, doch immer nur mit Mitteln, die auch diesem Kampf würdig waren, denn hier standen sich Edelmänner gegenüber. Mal erzielte der eine einen Treffer, dann der andere, doch keiner konnte einen großen Vorteil erringen und das meiste hielten die schweren Panzer ab.
Dann jedoch gelang es Baron Hektor, seinen Gegner zu Fall zu bringen. Einen Augenblick der Unachtsamkeit nutze er unerbittlich und der Fremde lag am Boden und hatte auch schon Hektors Schwertspitze an der Kehle.
„Ergebt ihr euch?“
„Ja, ich ergebe mich!“
Der Liegende erhob sich, beide steckten die Waffen weg und verneigten sich voreinander. Der Ehre war genüge getan.
Der Fremde bedauerte noch einmal zu tiefst, dass der Prinz von Thal so schwer verwundet wurde und war sichtlich erfreut darüber zu erfahren, dass es ihm schon wieder besser ginge.
Der Baron der Lormark wünschte den Namen des Fremden zu erfahren. Jener verwies wieder auf die höheren Eide, die er geschworen hatte und nannte ihn nicht. Als Ausgleich nahm er aber den Helm ab und zeigte dem Baron sein Gesicht. Dieses Gesicht würde Hektor von Eichenstein, Baron der Lormark sicher nicht vergessen.
Noch im Morgengrauen wurde der Gasthof verlassen. Der Tag schien zwar nicht regnerisch zu werden, aber es hingen doch einige Wolken am Himmel. Jedem war eines bewusst: Einen weiteren Angriff dieser Art würde die Gruppe nicht überstehen. Die Macht des Gegners war zu groß. Auch wurde viel darüber gesprochen, ob es besser gewesen wäre, sich zu trennen und die Kunstwerke auf verschiedenen Wegen zu transportieren. Keiner wusste es zu sagen, denn zu vieles an den Verfolgern war mysteriös. So verging die Zeit und man kam so gut es die Umstände erlaubten voran. Keine Stimmen, keine Gestalten im Unterholz.
Zur vierten Stunde kam am Horizont eine Gruppe Reiter in Sicht. Rüstungen waren zu erkennen und alsbald, waren die Wappenröcke der Heliosgarde des Königs zuzuordnen. Welche Erleichterung. Die Königlichen, angeführt von einem Heliosritter kamen vor den Reitern aus Idyllie zu stehen. „Mein Name ist Nicoforus und seine allerdurchlauchtigste Majestät der König schickt uns, um euch Geleit nach Escandra zu geben.“
Die Brieftaube, die Magister Dekanus Rasmus losgeschickt hatte, war also an ihrem Ziel angekommen.
Die Gardisten flankierten also die Gruppe um Prinz Anselm und gemeinsam ging es gegen Escandra. Nicht alle Zweifel waren durch diesen Schutz beseitigt. Würde es der unbekannte Gegner wagen, seine Hand auch gegen die Heliosgarde zu erheben? Doch nichts geschah.
Die Nächte waren so ruhig wie die Tage und eine halbe Woche später kamen die stolzen Mauern von Escandra, der Stadt des Königs in Sicht. Kein Torwächter wagte es, die Gruppe am Durchritt zu hindern, niemand stellte sich in den Weg, der geradewegs auf den Palast zu führte. Und als das angesteuerte Tor in Sicht kam, öffnete sich dieses, als hätte man auf die Reiter gewartet. Und mit dem betreten dieses Palastes, so groß und weitläufig wie ein ganzer Stadtteil wussten alle der elf, die aus Idyllie kamen, dass sie nun endgültig in Sicherheit waren. Wenn nicht hier, dann nirgends sonst.